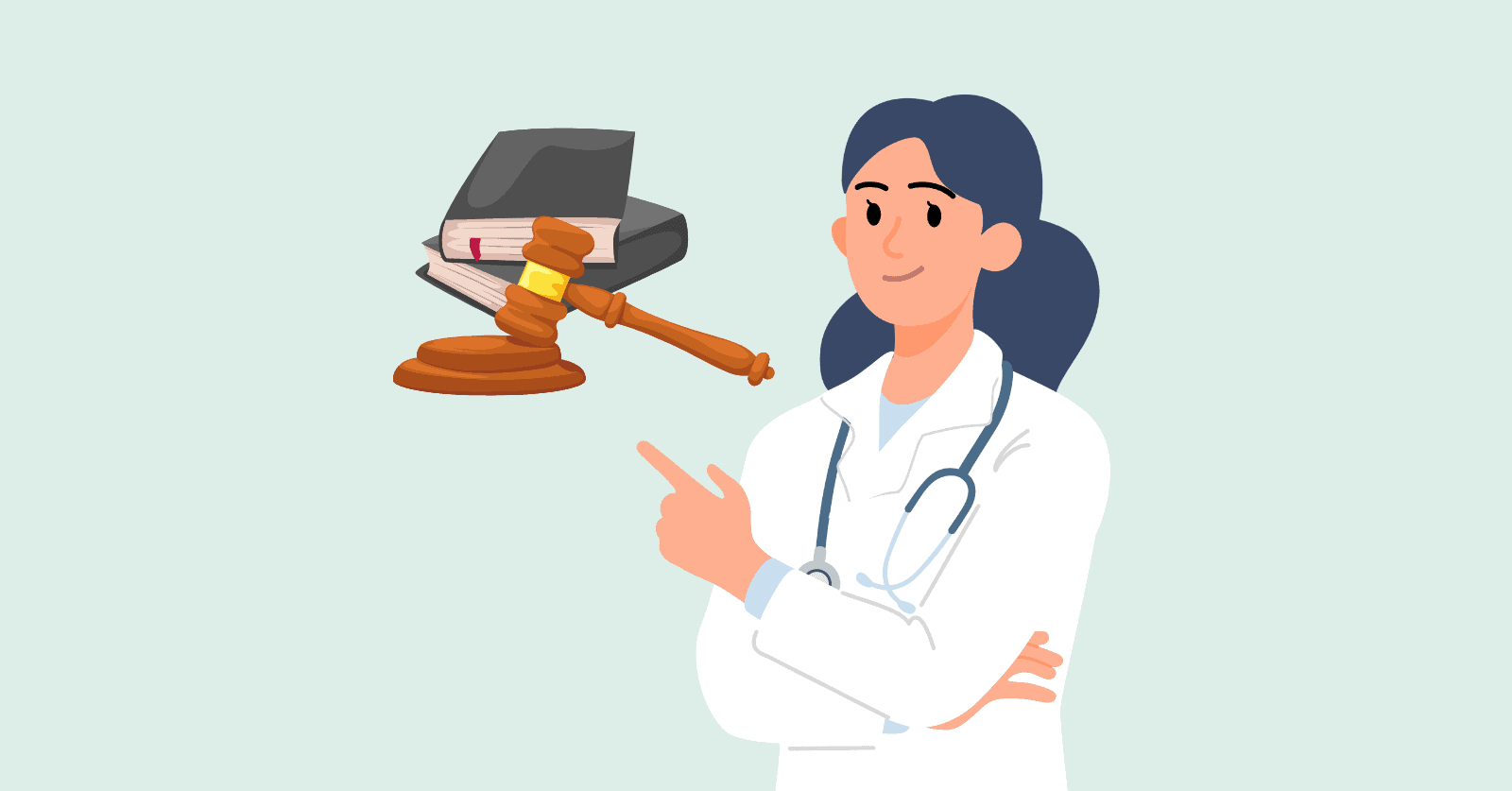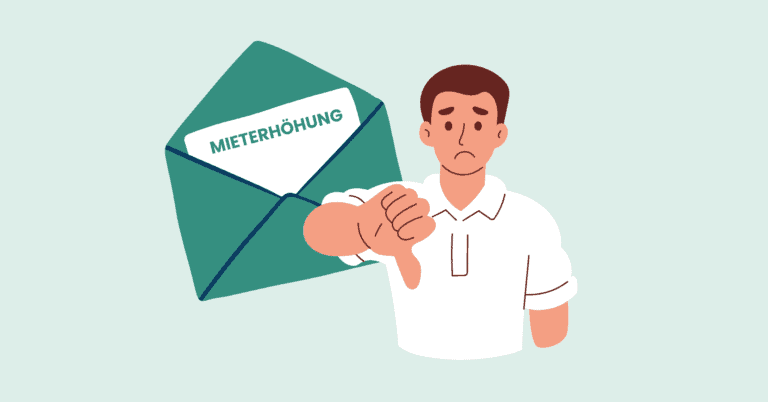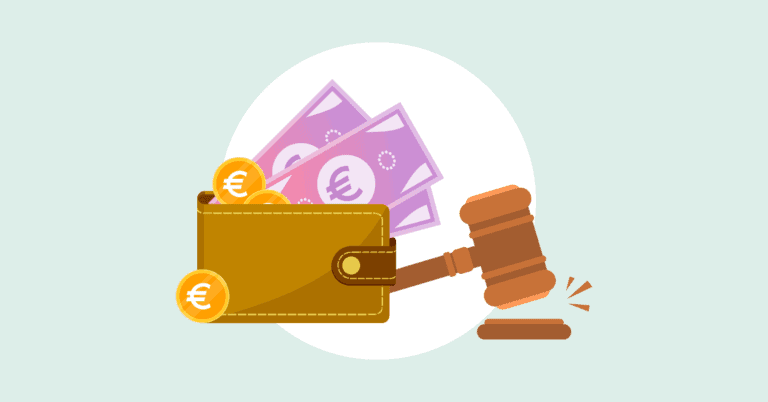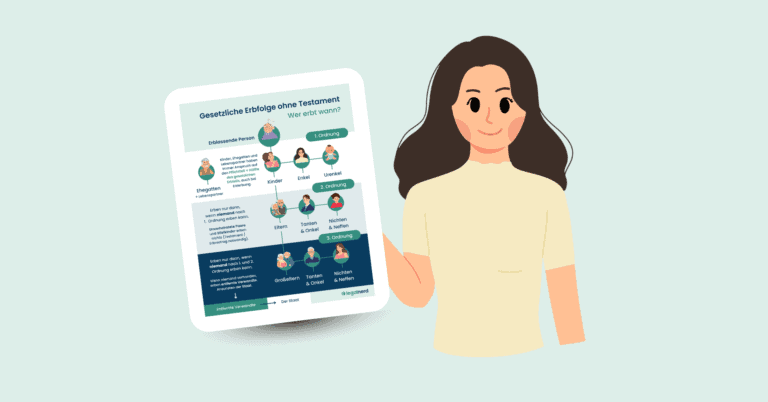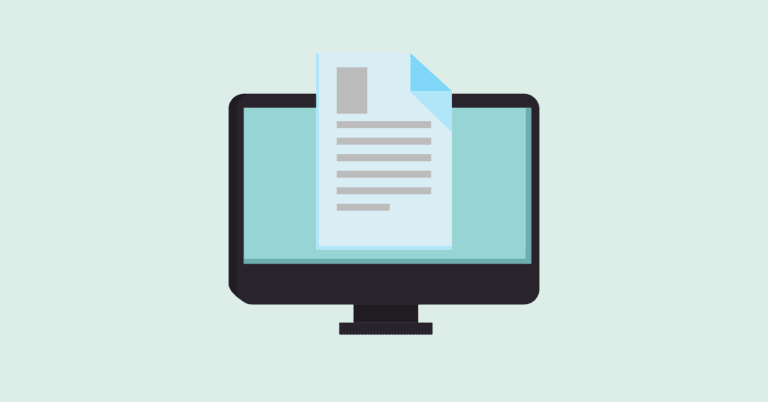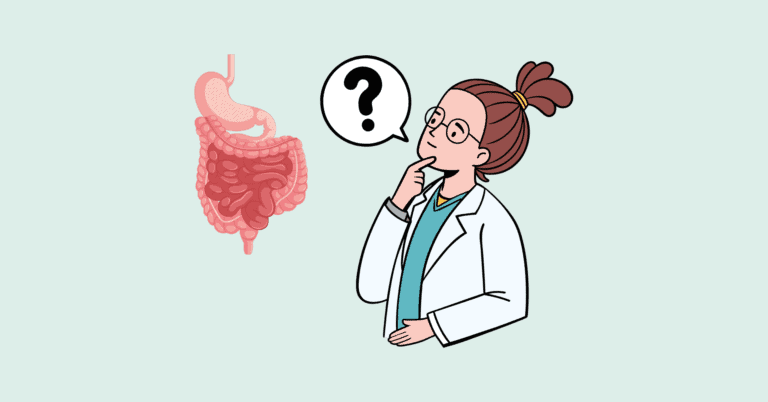Eine falsche Diagnose, eine fehlende Aufklärung oder das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden – viele Patient:innen kennen solche Situationen. Immer wieder sorgen Fälle für Schlagzeilen, bei denen eine fehlerhafte Behandlung zu schweren Gesundheitsschäden führt. Solche Ereignisse zeigen, wie wichtig es ist, das Arztrecht zu kennen. Egal ob du selbst Patient:in bist, Medizin studierst oder als Ärztin bzw. Arzt arbeitest, in diesem Beitrag erfährst du alles Wichtige dazu.
Wir bei legalnerd erklären Jura einfach und verständlich. Du willst mehr? Abonniere unseren wöchentlichen kostenlosen Newsletter oder folge uns auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!
Das Wichtigste in Kürze
✅ Das Arztrecht schützt u.a. Patientenrechte und legt ärztliche Pflichten fest. Es regelt, wie Behandlungen ablaufen müssen und welche Informationen Ärzt:innen geben müssen.
✅ Aufklärung und Einwilligung sind Pflicht. Ohne umfassende Information über Diagnose, Risiken und Alternativen darf keine Behandlung stattfinden – außer in Notfällen.
✅ Patient:innen können ihre Patientenakte einsehen und fehlerhafte Einträge löschen lassen. Das gilt auch für falsche Diagnosen, die medizinische oder versicherungsrechtliche Folgen haben könnten.
✅ Bei Behandlungsfehlern kannst du Schadensersatz oder Schmerzensgeld verlangen. Hierbei helfen Beweise wie Dokumentationen und medizinische Gutachten.
✅ Konflikte lassen sich oft außergerichtlich lösen. Schlichtungsstellen der Ärztekammer oder spezialisierte Anwält:innen für Medizinrecht können unterstützen, bevor es zu einem Prozess kommt.
Was ist das Arztrecht?
Das Arztrecht ist ein Teil des Medizinrechts und regelt die Rechte und Pflichten von Ärzt:innen im Umgang mit Patient:innen. Es dient vor allem dem Schutz der Patient:innen und sorgt dafür, dass medizinische Behandlungen nach hohen fachlichen Standards durchgeführt werden. Gleichzeitig schützt es Ärzt:innen vor ungerechtfertigten Vorwürfen, wenn sie nach anerkannten medizinischen Regeln handeln.
Die rechtliche Grundlage für das Arztrecht ergibt sich aus verschiedenen Gesetzen und Vorschriften. Eine zentrale Rolle spielt der Behandlungsvertrag nach §§ 630a–630h BGB. Dort ist festgelegt, wie die Beziehung zwischen Arzt oder Ärztin und Patient:in rechtlich ausgestaltet ist – von der ärztlichen Aufklärung bis zur Dokumentation. Daneben gelten die Berufsordnungen der Landesärztekammern und die Heilberufsgesetze der Bundesländer.
Auch das Sozialgesetzbuch (SGB V) hat großen Einfluss auf das Arztrecht, insbesondere für gesetzlich Versicherte. Es regelt unter anderem den Anspruch auf medizinische Versorgung, die Zulassung von Ärzt:innen und die Abrechnung ärztlicher Leistungen. Für privat Versicherte greifen dagegen oft vertragliche Regelungen zwischen Ärzt:innen und Patient:innen.
Zum Arztrecht gehört außerdem der Schutz sensibler Patientendaten. Ärzt:innen unterliegen einer strengen ärztlichen Schweigepflicht (§ 203 StGB), die nur in Ausnahmefällen durch eine Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht aufgehoben werden darf. Verstöße dagegen können sowohl strafrechtliche als auch berufsrechtliche Folgen haben.
In der Praxis zeigt sich das Arztrecht oft dann, wenn etwas schiefgeht, etwa bei einem Diagnosefehler oder einer fehlenden ärztlichen Aufklärung. Aber auch ohne Streitfälle ist es jeden Tag relevant: von der Patientenaufnahme über die Rezeptausstellung bis hin zur Entlassung aus dem Krankenhaus.
Unsere Plattform dient der rechtlichen Aufklärung. Dies ersetzt jedoch keine Rechtsberatung durch Expert:innen, die wir gerne vermitteln. Mit dem Ausfüllen des Formulars willigst du in diese Datenverarbeitung ein. Deine Daten werden rechtskonform verarbeitet und können jederzeit auf Anfrage gelöscht werden. Mehr Infos dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Welche Rechte und Pflichten haben Ärzte?
Das Arztrecht legt genau fest, welche Pflichten Ärzt:innen gegenüber ihren Patient:innen haben. Diese Pflichten sollen sicherstellen, dass jede Behandlung nach dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft erfolgt und dass Patient:innen in ihren Rechten geschützt werden.
Eine der wichtigsten Vorgaben ist die Aufklärungspflicht (§ 630e BGB). Bevor eine Behandlung beginnt, müssen Ärzt:innen ihre Patient:innen umfassend über Diagnose, Behandlungsverlauf, Risiken und mögliche Alternativen informieren. Nur wenn die Patient:innen anschließend ausdrücklich einwilligen, darf die Behandlung erfolgen. Eine fehlende oder fehlerhafte Aufklärung kann zu Schadensersatzansprüchen führen.
Genauso wichtig ist die Dokumentationspflicht (§ 630f BGB). Ärzt:innen müssen den Verlauf der Behandlung, Diagnosen und wichtige Entscheidungen schriftlich in der Patientenakte festhalten. Patient:innen haben das Recht, ihre Krankenakten anzufordern und gegebenenfalls falsche Einträge wie eine unzutreffende Diagnose löschen zu lassen.
Ein weiterer zentraler Punkt ist die ärztliche Schweigepflicht. Ohne ausdrückliche Zustimmung dürfen Ärzt:innen keine Informationen an Dritte weitergeben. Nur in Ausnahmefällen, etwa mit einer Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht, dürfen sensible Daten weitergegeben werden.
Zusätzlich schreibt die Berufsordnung der Landesärztekammern eine Fortbildungspflicht vor. Ärzt:innen müssen sich regelmäßig über neue medizinische Erkenntnisse informieren, um ihre Patient:innen fachgerecht behandeln zu können. Auch organisatorische Pflichten, wie eine sichere Praxisführung und der Schutz vor Behandlungsfehlern, gehören zu den täglichen Aufgaben.
Neben Pflichten haben Ärzt:innen aber auch eigene Rechte – zum Beispiel das Recht, unter bestimmten Umständen Patient:innen abzulehnen, solange keine akute Notlage besteht.
Patientenrecht: Rechte von Patienten im Arztrecht
Das Arztrecht schützt nicht nur Ärzt:innen, sondern gibt vor allem Patientenrechte klar vor. Diese Rechte sind größtenteils in den §§ 630a–630h BGB geregelt und sollen sicherstellen, dass du als Patient:in über alle wichtigen Schritte deiner Behandlung informiert bist und selbstbestimmt entscheiden kannst.
Ein zentrales Recht ist die ärztliche Aufklärung. Bevor du einer Behandlung zustimmst, muss dich dein Arzt oder deine Ärztin umfassend über Diagnose, Therapieverlauf, mögliche Risiken und Behandlungsalternativen informieren. Erst danach kannst du wirksam einwilligen. Ohne diese Einwilligung darf keine Behandlung stattfinden, außer in echten Notfällen.
Du hast außerdem das Recht, deine Patientenakte einzusehen. Falls dort fehlerhafte oder veraltete Einträge stehen, kannst du diese unter bestimmten Voraussetzungen löschen lassen. Das ist besonders wichtig, wenn falsche Diagnosen deine weitere medizinische Behandlung oder Versicherungsleistungen beeinflussen könnten.
Kommt es zu einem Behandlungsfehler, hast du das Recht, Schadensersatz oder Schmerzensgeld zu verlangen (§ 280 BGB). Dabei kann es sich um einen Diagnosefehler, einen Therapiefehler oder einen Organisationsfehler handeln. In solchen Fällen kann der Gang zu einer spezialisierten Anwältin oder einem Anwalt für Patientenrecht helfen, um deine Ansprüche durchzusetzen.
Außerdem hast du Anspruch auf eine ordnungsgemäße medizinische Versorgung, unabhängig davon, ob du gesetzlich oder privat versichert bist. Für gesetzlich Versicherte gilt dies nach dem Sozialgesetzbuch (SGB V), privat Versicherte berufen sich auf den individuellen Behandlungsvertrag.
Arztrecht: Behandlungsfehler und Haftung
Ein Behandlungsfehler liegt vor, wenn eine ärztliche Behandlung nicht dem anerkannten Stand der medizinischen Wissenschaft entspricht und dadurch ein Schaden entsteht. Das kann durch falsche Diagnosen, fehlerhafte Therapien oder organisatorische Versäumnisse passieren.
Arten von Behandlungsfehlern im Arztrecht
Rechtlich unterscheidet man verschiedene Arten von Behandlungsfehlern:
- Diagnosefehler: Eine falsche oder zu spät gestellte Diagnose
- Therapiefehler: Eine falsche oder nicht indizierte Behandlung
- Organisationsfehler: Mängel in Praxis- oder Krankenhausabläufen
Voraussetzungen für eine Haftung
Damit eine Ärztin oder ein Arzt haftet, müssen – vereinfacht erklärt – drei große Voraussetzungen erfüllt sein:
Pflichtverletzung: z. B. fehlerhafte Behandlung oder mangelnde Aufklärung
Schaden: körperlich, gesundheitlich oder finanziell
Kausalität: – der Fehler muss ursächlich für den Schaden sein
Bei einer juristischen Beurteilung eines Haftungsfalls kommen natürlich weitere Tatbestände und Tatbestandsmerkmale hinzu. Dies kann allerdings nur eine Anwältin oder ein Anwalt für Medizinrecht im Einzelfall beurteilen.
Das Arztrecht kennt zudem besondere Beweisregeln. Bei groben Behandlungsfehlern gilt eine Beweislastumkehr (§ 630h BGB). Das bedeutet: Nicht mehr du musst beweisen, dass der Fehler den Schaden verursacht hat, sondern die Ärztin oder der Arzt muss beweisen, dass es nicht so war.
Gegen Ärztepfusch vorgehen
Beispiele zeigen, wie schwerwiegend die Folgen sein können: Eine Patientin erhält eine falsche Krebsdiagnose und wird daraufhin “unnötig” operiert. Später stellte sich heraus, dass der Befund auf einer Verwechslung der Laborproben beruhte – ein klassischer Organisationsfehler. Die Patientin kann in so einem Fall wahrscheinlich erfolgreich Schadensersatz und Schmerzensgeld wegen Ärztepfusch geltend machen.
Wer den Verdacht auf Ärztepfusch hat, kann den Fall dokumentieren, die Patientenakte anfordern und sich an eine spezialisierte Anwältin oder einen Anwalt für Medizinrecht wenden. In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, direkt Klage gegen den Arzt oder die Ärztin einzureichen, auch wenn du keine Rechtsschutzversicherung hast.
Wer haftet im Krankenhaus vs. in der Arztpraxis?
Das Arztrecht gilt sowohl für Ärzt:innen in eigener Praxis als auch für Ärzt:innen im Krankenhaus. Allerdings gibt es Unterschiede in den Pflichten, Verantwortlichkeiten und der Haftung.
In einer Arztpraxis ist die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt in der Regel selbst Vertragspartner:in der Patient:innen. Kommt es zu einem Behandlungsfehler, haftet in erster Linie die Praxisinhaberin oder der Praxisinhaber. Angestellte Ärzt:innen sind zwar verpflichtet, nach den Regeln der “ärztlichen Kunst” zu arbeiten, werden aber oft durch den Praxisinhaber bzw. die Praxisinhaberin abgesichert.
Im Krankenhaus sieht es anders aus: Hier ist der Vertragspartner meist das Krankenhaus selbst. Das bedeutet, dass im Schadensfall oft die Klinik haftet, nicht direkt die einzelne Ärztin oder der einzelne Arzt. Eine Ausnahme besteht bei der Chefarztbehandlung. Wenn du einen Vertrag mit einer Chefärztin oder einem Chefarzt abschließt, haftet diese:r in vielen Fällen persönlich.
Besonders wichtig ist im Krankenhaus die Organisation: Bei komplexen Abläufen, vielen Beteiligten und Schichtdiensten kommt es schneller zu Organisationsfehlern. Das Arztrecht sieht vor, dass Kliniken funktionierende Strukturen schaffen müssen, um Fehler zu vermeiden, etwa bei der Patientenidentifikation oder der Medikamentenvergabe.
Auch spezielle Bereiche wie das Arzneimittelrecht spielen hier eine Rolle, zum Beispiel bei der Verschreibung von Betäubungsmitteln. Wer eine besondere Behandlung möchte, wie etwa eine Therapie mit medizinischem Cannabis, muss die gesetzlichen Voraussetzungen kennen. Mehr dazu findest du im Artikel: Wie wird man Cannabis-Patient?
Unabhängig vom Behandlungsort gilt: Ärzt:innen müssen ihre Patient:innen immer über Behandlungsalternativen informieren, den Ablauf dokumentieren und die Schweigepflicht wahren. Ob in Praxis oder Klinik – Verstöße können sowohl zivilrechtliche als auch berufsrechtliche Folgen haben.
Was tun bei einem Konflikt im Arztrecht?
Die folgenden Informationen dienen nur als erste Orientierung und ersetzen keine individuelle Rechtsberatung. Für eine verbindliche Auskunft solltest du dich immer an eine spezialisierte Anwältin oder einen spezialisierten Anwalt für Medizinrecht wenden, da unsere Inhalte unvollständig oder veraltet sein können.
Kommt es zu Problemen mit einer Ärztin oder einem Arzt (sei es wegen einer falschen Behandlung, fehlender Aufklärung oder Streit über die Kosten), kannst du zunächst das Gespräch suchen. Kläre ruhig und sachlich, was genau vorgefallen ist, und dokumentiere alle wichtigen Details, am besten schriftlich.
Als nächstes kannst du deine Patientenakte anfordern. So bekommst du Einblick in Diagnosen, Behandlungsverlauf und ärztliche Notizen. Falls dort falsche Angaben stehen, kannst du unter bestimmten Umständen eine Löschung der Diagnose beantragen.
Falls das Gespräch keine Lösung bringt, kann sich der Gang zur Ärztekammer lohnen. Dort gibt es Schlichtungsstellen, die Beschwerden prüfen und zwischen Patient:innen und Ärzt:innen vermitteln. Das ist oft schneller und kostengünstiger als ein Gerichtsverfahren.
Bleiben die Fronten verhärtet, kann eine spezialisierte Anwältin oder ein Anwalt für Medizinrecht helfen. Dort erfährst du, ob eine Klage Erfolg verspricht und welche Beweise wichtig sind. In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, die Ärztin oder den Arzt zu verklagen. Gerade bei komplexen Fällen empfiehlt es sich, frühzeitig juristischen Rat einzuholen, um keine Fristen zu verpassen und die eigenen Rechte wahrzunehmen.
Fazit
Das Arztrecht regelt die Beziehung zwischen Ärzt:innen und Patient:innen – von der Aufklärung vor einer Behandlung bis zur Haftung bei Fehlern. Für Patient:innen ist es wichtig, ihre Rechte zu kennen, um im Konfliktfall gezielt handeln zu können. Ärzt:innen wiederum profitieren von klaren Vorgaben, die sowohl den Behandlungserfolg sichern als auch vor ungerechtfertigten Vorwürfen schützen. Wer die Grundlagen des Arztrechts versteht, kann medizinische Entscheidungen besser einschätzen und seine eigenen Interessen wirksam vertreten.