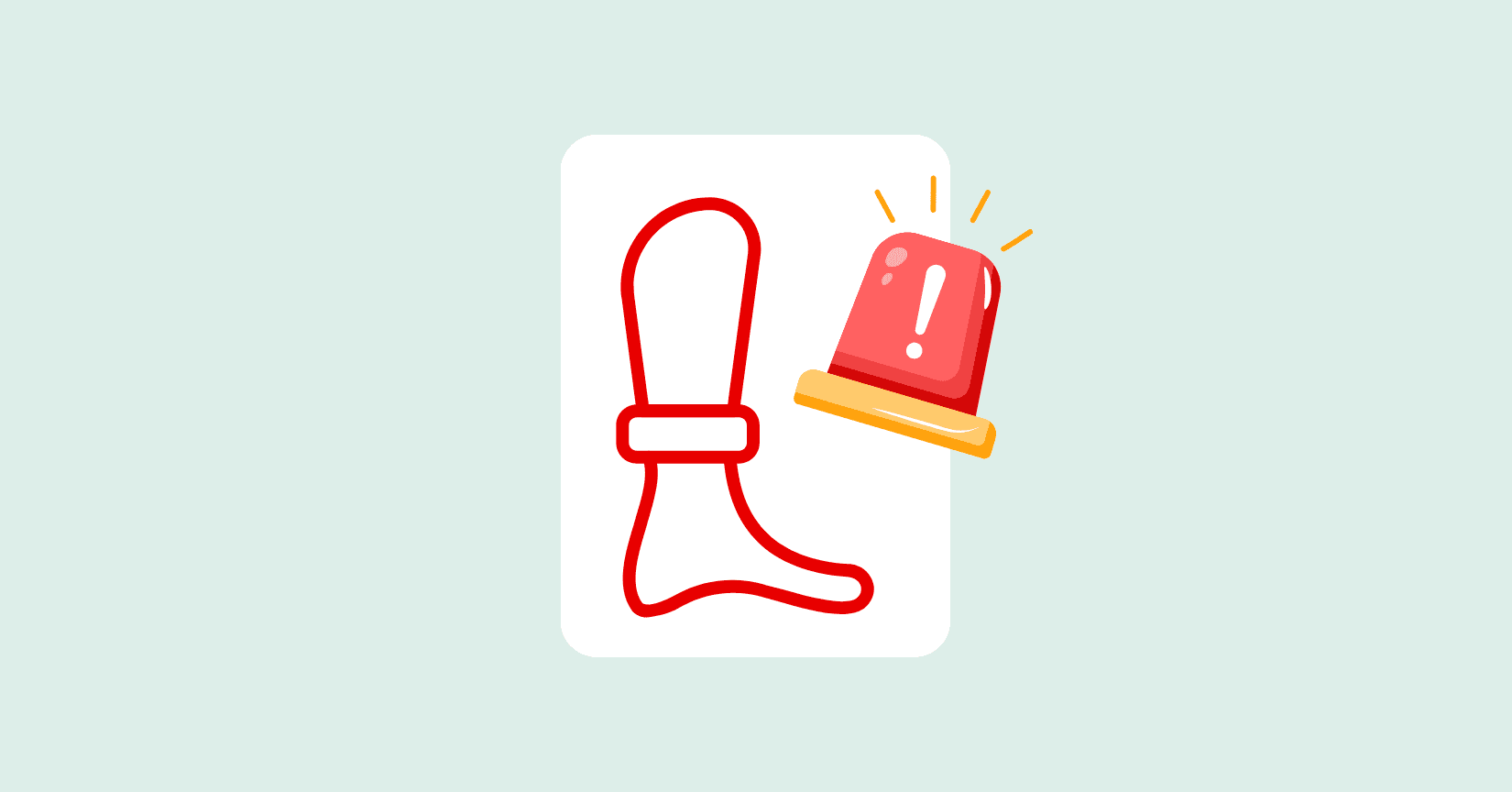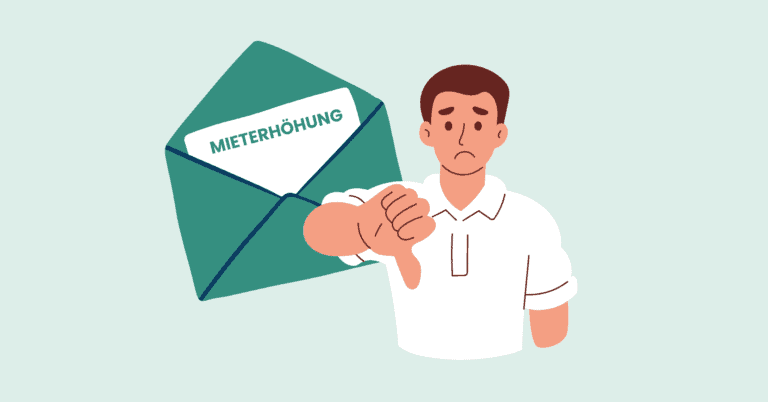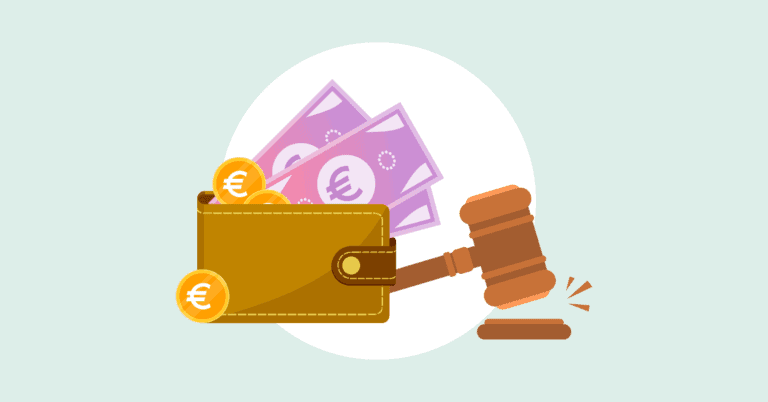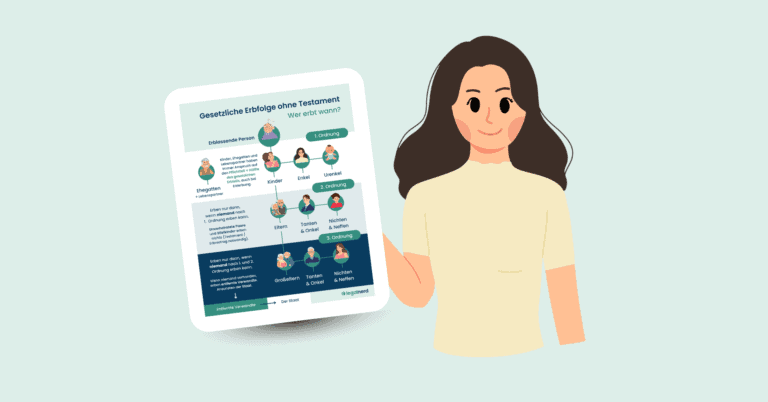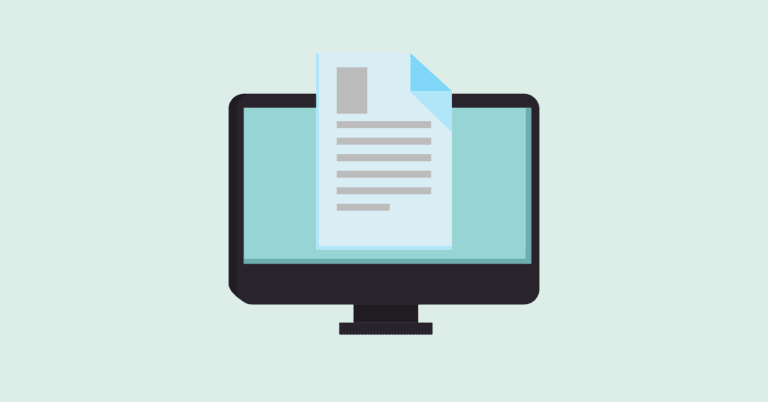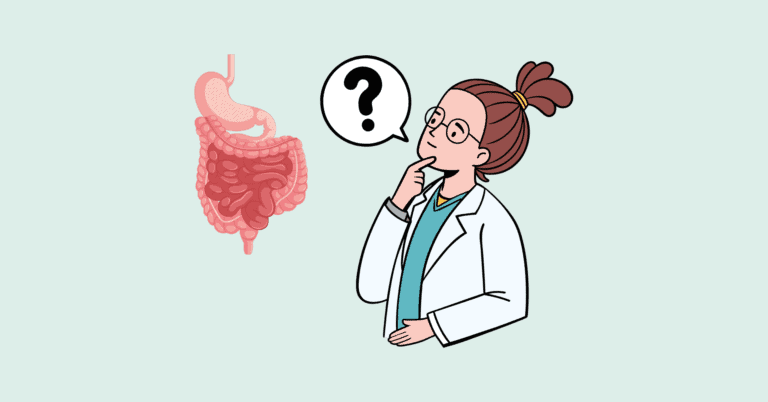Du rufst fünfmal die Polizei, weil dein Ex-Partner dir droht – aber erst nach der sechsten Anzeige wird er festgenommen. In Deutschland ist das keine Ausnahme. Fast jeden Tag wird eine Frau von ihrem (Ex-)Partner getötet. 2023 stieg die Zahl der Opfer häuslicher Gewalt erneut an – auf über 256.000 Fälle. Die Politik will jetzt reagieren: Mit einer elektronischen Fußfessel sollen gefährliche Täter überwacht und Opfer besser geschützt werden. Ein Pilotprojekt in Hessen testet bereits, wie das funktionieren kann. Doch reicht das wirklich?
Wir bei legalnerd erklären Jura einfach und verständlich. Du willst mehr? Abonniere unseren wöchentlichen kostenlosen Newsletter oder folge uns auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!
Wir bei legalnerd erklären Jura einfach und verständlich. Du willst mehr? Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, höre in unseren Podcast rein oder folge uns auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!
Das Wichtigste in Kürze
✅ Die Zahl häuslicher Gewalttaten in Deutschland steigt – vor allem gegen Frauen. Im Jahr 2023 wurden über 256.000 Fälle registriert, darunter fast täglich ein Femizid. Besonders gefährdet sind Frauen im sozialen Nahbereich. Viele Täter sind (Ex-)Partner.
✅ Die Bundesregierung will mit einer Fußfessel gefährliche Täter überwachen. In akuten Hochrisikofällen sollen Familiengerichte künftig elektronische Aufenthaltsüberwachung anordnen dürfen. Zunächst für 3 Monate, verlängerbar auf 6 Monate. Parallel können verpflichtende Anti-Gewalt-Kurse angeordnet werden.
✅ Das System basiert auf dem spanischen Modell: Täter und Opfer tragen jeweils ein Gerät. Der Täter wird per GPS überwacht, das Opfer erhält einen Panikknopf. Bei Annäherung löst das System Alarm aus – die Polizei kann sofort eingreifen. Hessen testet das Modell bereits in einem Pilotprojekt.
✅ Politik und Fachleute begrüßen die Idee, warnen aber vor überhöhten Erwartungen. Die Fußfessel kann Schutz bieten, ersetzt aber keine umfassenden Maßnahmen wie Beratung, Frauenhäuser oder Prävention. Wichtig ist eine solide Finanzierung und technische Zuverlässigkeit.
✅ Das Bundesverfassungsgericht sieht die Fußfessel als verfassungsgemäß, aber nur zulässig unter strengen Bedingungen. Sie darf eingesetzt werden – vorausgesetzt, es besteht eine konkrete Rückfallgefahr, die Maßnahme ist gesetzlich klar geregelt und Datenschutz sowie Verhältnismäßigkeit sind gewahrt.
Wie häufig ist häusliche Gewalt in Deutschland wirklich?
Die Zahlen sind erschreckend: 2023 wurden laut Bundeskriminalamt über 256.000 Menschen Opfer von häuslicher Gewalt – das sind 6,5 % mehr als im Vorjahr (BMFSFJ, 2024). Besonders betroffen sind Frauen: Rund 70 % der Betroffenen sind weiblich, viele von ihnen leben mit dem Täter im gleichen Haushalt. Die häufigsten Täter sind Ex-Partner oder aktuelle Lebensgefährten.
Jeden Tag ein Femizid in Deutschland?
Besonders alarmierend ist die Entwicklung bei Femiziden, also Tötungsdelikten an Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Fast täglich wird in Deutschland eine Frau von ihrem (Ex-)Partner getötet. 2023 waren es 938 Frauen, die Opfer von Tötungsdelikten wurden, rund 80 % davon im engen sozialen Umfeld.
Sexuelle Gewalt gegen Frauen in Deutschland
Auch die sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen nimmt zu: Über 52.000 Fälle wurden 2023 erfasst, ein Anstieg um 6,2 %. Besonders dramatisch: Über die Hälfte der Betroffenen sind minderjährig. Daneben gibt es eine zunehmende Zahl digitaler Gewalt, etwa durch Stalking per Handy oder GPS-Tracking. Über 17.000 Frauen meldeten solche Vorfälle.
Kinder, die mit Gewalttätern aufwachsen, erleben oft psychische oder körperliche Misshandlung, auch wenn sie nicht direkt betroffen sind. Das Bundesfamilienministerium weist darauf hin, dass viele Kinder „mitleiden und mitgeschlagen“ werden. Langfristige Folgen wie Angststörungen oder Bindungsprobleme sind keine Seltenheit.
Aktuell stehen bundesweit rund 400 Frauenhäuser und über 800 Fachberatungsstellen zur Verfügung. Doch viele Einrichtungen sind überlastet, Plätze fehlen, Wartezeiten sind lang. Immer wieder berichten Betroffene, dass sie trotz akuter Bedrohung keinen Schutzplatz finden.
Unsere Plattform dient der rechtlichen Aufklärung. Dies ersetzt jedoch keine Rechtsberatung durch Expert:innen, die wir gerne vermitteln. Mit dem Ausfüllen des Formulars willigst du in diese Datenverarbeitung ein. Deine Daten werden rechtskonform verarbeitet und können jederzeit auf Anfrage gelöscht werden. Mehr Infos dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Was genau ist die Fußfessel und wie funktioniert sie?
Die sogenannte elektronische Fußfessel ist ein Gerät, das Täter am Knöchel tragen. Es sendet per GPS-Signal ständig den aktuellen Aufenthaltsort an eine Überwachungszentrale. Sobald sich die Person einer bestimmten, vorher festgelegten Zone nähert (zum Beispiel dem Wohnort des Opfers), schlägt das System Alarm. Zusätzlich erhält auch die Polizei eine Meldung und kann sofort eingreifen (Tagesschau, 08.01.2025).
Das Modell, das Deutschland nun erstmals einführt, orientiert sich am spanischen Vorbild: Dort tragen nicht nur die Täter ein Gerät, sondern auch die Opfer in Form eines Empfangsgeräts mit Panikknopf. Dieses erkennt die Annäherung des Täters und ermöglicht es dem Opfer, per Knopfdruck Hilfe zu rufen. Spanien verzeichnet seit Einführung des Systems einen deutlichen Rückgang tödlicher Gewalt gegen Frauen (Justizministerium Hessen, 2024).
Technisch funktioniert das System über ein GSM- und GPS-Modul, das jede Positionsänderung des Täters erfasst. Die Daten werden in Echtzeit ausgewertet und mit sogenannten „No-Go-Zonen“ abgeglichen. Sobald ein Täter eine solche Zone betritt oder sich ihr nähert, wird automatisch eine Interventionskette in Gang gesetzt.
Fußfessel in Deutschland: Welche Daten werden erhoben und wer darf sie sehen?
Erfasst werden nur Bewegungsprofile, keine Gespräche oder andere private Informationen. Zugriff haben ausschließlich die Behörden, die für die Überwachung zuständig sind, etwa Polizei oder zentrale Überwachungsstellen. Laut dem Bundesjustizministerium soll der Datenschutz dabei umfassend gewahrt bleiben. Trotzdem fordern Datenschützer:innen strengere gesetzliche Vorgaben.
Die Kosten für die Technik trägt in der Regel der Staat. In Spanien liegen sie bei rund 300 Euro pro Monat und Person. In Deutschland sind die genauen Kosten noch nicht beziffert, Pilotprojekte wie in Hessen liefern erste Erfahrungswerte.
Ein wichtiger Unterschied zu bisherigen Fußfesseln: Früher kamen sie in Deutschland vor allem bei Sexualstraftätern oder Gefährdern zum Einsatz, also im Strafvollstreckungsrecht. Jetzt aber soll die Fußfessel präventiv zum Schutz vor häuslicher Gewalt eingesetzt werden. Das ist juristisch ein völlig neuer Ansatz.
Neue Regelung im Gewaltschutzgesetz: Was plant die Bundesregierung?
Am 8. Januar 2025 hat das Bundeskabinett eine Änderung des Gewaltschutzgesetzes (§ 1 GewSchG) beschlossen. Ziel ist es, gefährdete Personen besser vor Übergriffen zu schützen. Vor allem in akuten Hochrisikofällen, also wenn für Leib oder Leben einer Person unmittelbare Gefahr besteht. Künftig sollen Gerichte in solchen Fällen eine elektronische Aufenthaltsüberwachung – also die Fußfessel – anordnen können (Tagesschau, 08.01.2025).
Die Fußfessel darf zunächst für 3 Monate angeordnet werden. Liegt weiterhin eine konkrete Gefahr vor, kann sie um weitere 3 Monate verlängert werden. Zuständig für die Entscheidung ist das Familiengericht, nicht das Strafgericht. Die Maßnahme soll rein präventiv sein, also auch unabhängig davon, ob bereits eine Verurteilung vorliegt.
Neu ist auch, dass Gerichte künftig verpflichtend sogenannte Anti-Gewalt-Kurse anordnen können. Die Täter müssen dann aktiv an Schulungen teilnehmen, die Verhalten reflektieren und Gewaltbereitschaft abbauen sollen. Das soll nicht nur die Opfer schützen, sondern auch langfristig das Rückfallrisiko senken.
Rechtsgrundlage für all das ist eine geplante Ergänzung im Gewaltschutzgesetz, das bislang vor allem Kontakt- und Näherungsverbote regelt. Die neue Regelung soll präzise Kriterien enthalten: Wer darf überwacht werden, unter welchen Bedingungen, und welche Behörden sind zuständig? Auch technische Mindeststandards und Datenschutzregelungen sollen im Gesetz verankert werden.
Kritiker:innen warnen jedoch vor einem übereilten Gesetzgebungsverfahren. Die Technik sei in Deutschland noch nicht flächendeckend getestet und es fehle an einheitlichen Standards.
Urteil des BVerfG: Ist die Fußfessel verfassungsgemäß?
Die elektronische Aufenthaltsüberwachung (“Fußfessel”) stellt einen schweren Eingriff in die Grundrechte dar. Betroffen sind vor allem die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG), das Recht auf informationelle Selbstbestimmung sowie das Resozialisierungsgebot aus Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 2 GG. In seinem Beschluss vom 1. Dezember 2020 (Az. 2 BvR 916/11, 2 BvR 636/12) erklärte das Bundesverfassungsgericht die damalige Regelung zur Fußfessel im Strafvollzug für verfassungsgemäß.
Die Richter:innen betonten, dass die Vorschriften in § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 StGB in Verbindung mit § 463a Abs. 4 StPO den Anforderungen an Normenklarheit, Verhältnismäßigkeit und Datenschutz genügen. Das BVerfG hat also entschieden, dass die elektronische Aufenthaltsüberwachung als Maßnahme der Führungsaufsicht unter die Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Art. 74 Absatz 1 Nr. 1 GG falle und verfassungsgemäß sei.
Eingriff in Grundrechte ist gerechtfertigt
Die Vorschriften würden laut dem BVerfG-Beschluss weder in den Kernbereich privater Lebensgestaltung eingreifen noch gegen die Menschenwürde verstoßen.
Die Einschränkungen der allgemeinen Handlungsfreiheit seien zum Schutz hochrangiger Rechtsgüter wie Leben, körperliche Unversehrtheit und sexuelle Selbstbestimmung gerechtfertigt.
Auch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung sei nicht verletzt, da die gesetzlichen Regelungen die datenschutzrechtlichen Anforderungen erfüllten. Ein Sachverständigengutachten müsse nicht zwingend eingeholt werden, könne aber im Einzelfall aus dem verfassungsrechtlichen Gebot bestmöglicher Sachaufklärung folgen. Zudem sei der Gesetzgeber verpflichtet, die spezialpräventiven Wirkungen und technischen Rahmenbedingungen der Maßnahme empirisch zu beobachten und das Gesetz gegebenenfalls anzupassen.
Zulässig ist der Einsatz laut Urteil aber nur bei schwerer Rückfallgefahr, etwa bei Straftaten gegen Leib, Leben oder die sexuelle Selbstbestimmung. Voraussetzung ist zudem, dass die betroffene Person eine Freiheitsstrafe von mindestens 3 Jahren verbüßt hat und die Gefahr weiterer schwerer Straftaten besteht.
Zwar bezog sich der Beschluss auf den Strafvollzug und die Führungsaufsicht, doch lassen sich die Maßstäbe auch auf den geplanten Einsatz der Fußfessel bei häuslicher Gewalt übertragen. Auch hier braucht es eine klare gesetzliche Grundlage, eine verhältnismäßige Anwendung und einen strengen Datenschutz.
Fußfessel in Deutschland eingeführt: Pilotprojekte in den ersten Bundesländern
Während die Gesellschaft noch über die Gesetzesänderung diskutiert, testen einige Bundesländer die Fußfessel bereits in der Praxis. Hessen ist hier Vorreiter: Seit 2024 läuft dort ein Pilotprojekt, das direkt auf dem spanischen Modell basiert. Dabei wird nicht nur der Täter überwacht. Auch das Opfer erhält ein Gerät, das bei Annäherung des Täters Alarm schlägt. Laut dem Justizministerium Hessen handelt es sich um einen bundesweit einmaligen Versuch.
In Hessen arbeiten Polizei, Justiz und Opferschutzorganisationen eng zusammen. Die ersten Tests zeigen, dass die Technik funktioniert. Aber es gibt auch Herausforderungen: So müssen alle Beteiligten gut geschult sein und es braucht klare Abläufe, was bei einem Alarm passiert. Außerdem zeigt sich, dass viele Betroffene die Maßnahme begrüßen, weil sie sich dadurch sicherer fühlen.
Auch andere Länder ziehen nach. In Schleswig-Holstein forderte der Opferschutzverband Weißer Ring bereits frühzeitig, das spanische Modell zu übernehmen. Nordrhein-Westfalen prüft laut Medienberichten eine ähnliche Lösung. Hier soll die Fußfessel mit psychosozialer Prozessbegleitung kombiniert werden, also mit Unterstützung für die Opfer während des gesamten Verfahrens.
Frauenhäuser und Beratungsstellen begrüßen die Idee grundsätzlich, fordern aber, dass die Technik nicht isoliert betrachtet wird. Viele warnen davor, die Fußfessel als Allheilmittel darzustellen. Ohne begleitende Maßnahmen wie Anti-Gewalt-Trainings, sichere Unterkünfte und psychosoziale Hilfe sei der Schutz oft unzureichend.
Ein weiteres Problem: Finanzierung und Kapazitäten. Die Bundesländer müssen entscheiden, ob sie Geld für Technik, Schulung und Personal bereitstellen. Bisher gibt es keine bundesweit einheitliche Lösung: jedes Land entscheidet selbst, ob es mitmacht. Das könnte zu einem Flickenteppich beim Opferschutz führen.
Fazit
Die Fußfessel bei häuslicher Gewalt kann ein sinnvoller Schutz sein – wenn sie gezielt und rechtskonform eingesetzt wird. Sie bietet Opfern mehr Sicherheit, besonders in akuten Gefahrensituationen. Doch allein reicht sie nicht: Ohne Anti-Gewalt-Trainings, Beratung und sichere Unterkünfte bleibt sie Symbolpolitik. Technik darf keine Ersatzlösung für fehlende Schutzstrukturen sein. Nur als Teil eines umfassenden Gesamtkonzepts kann die Fußfessel wirklich Leben retten.