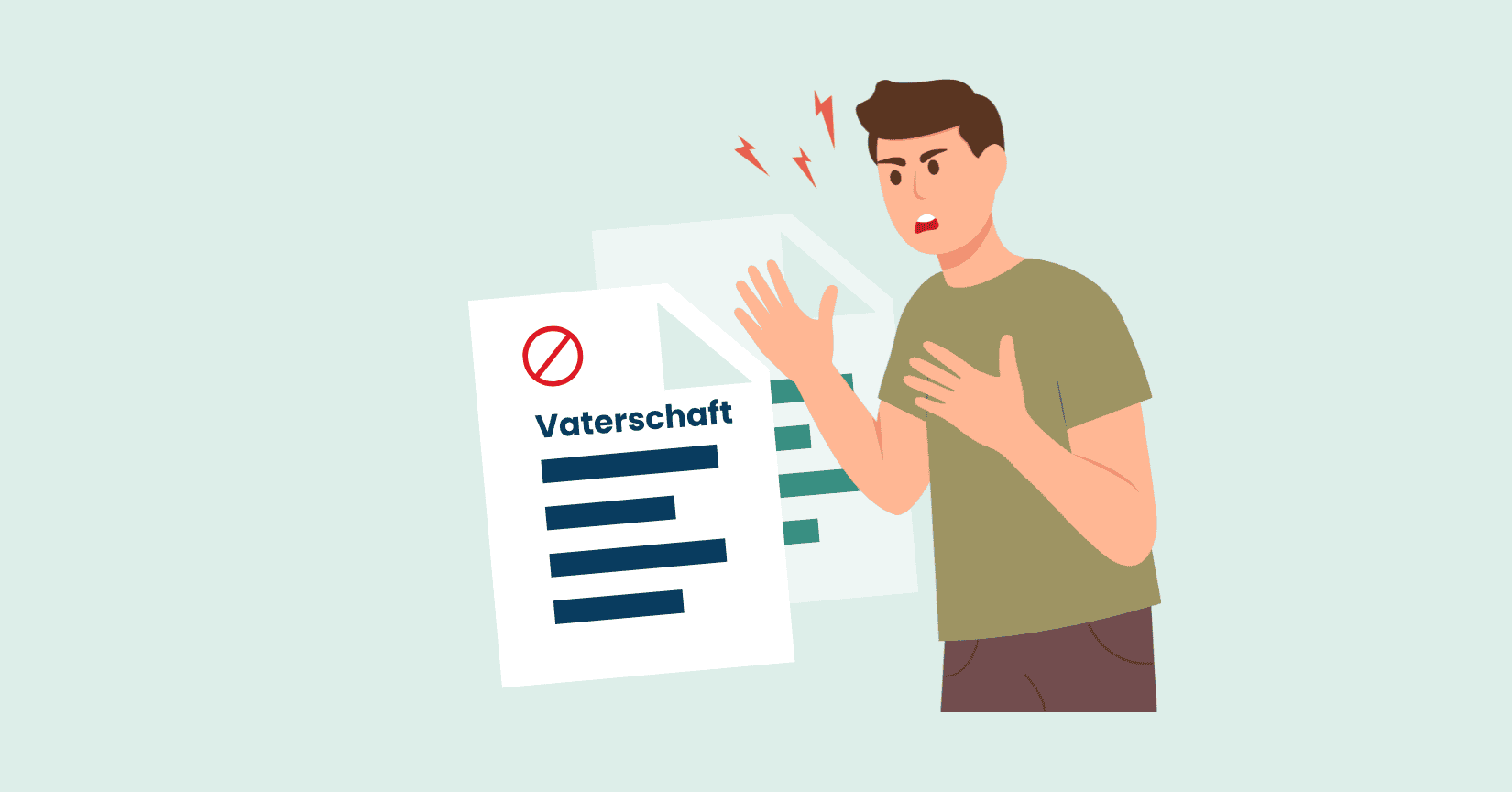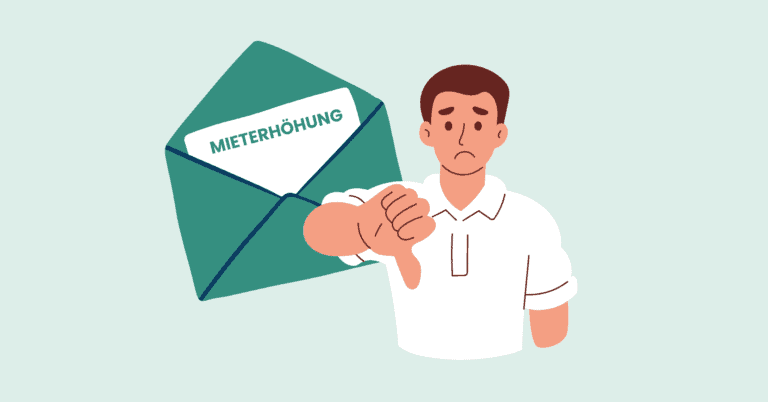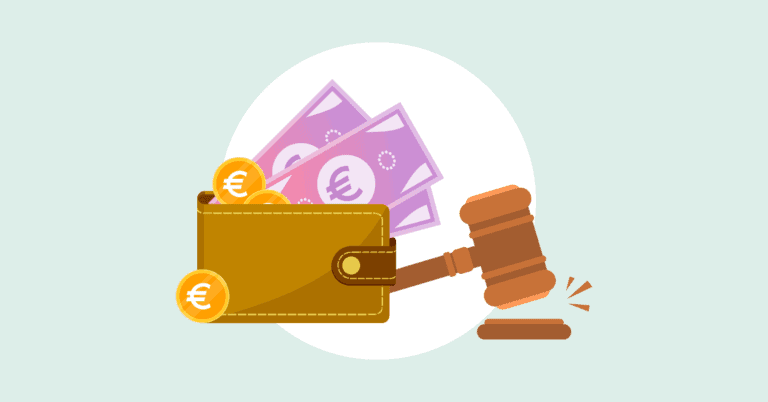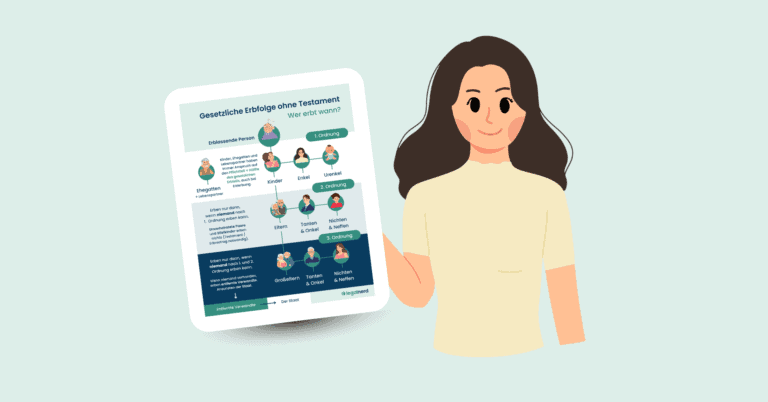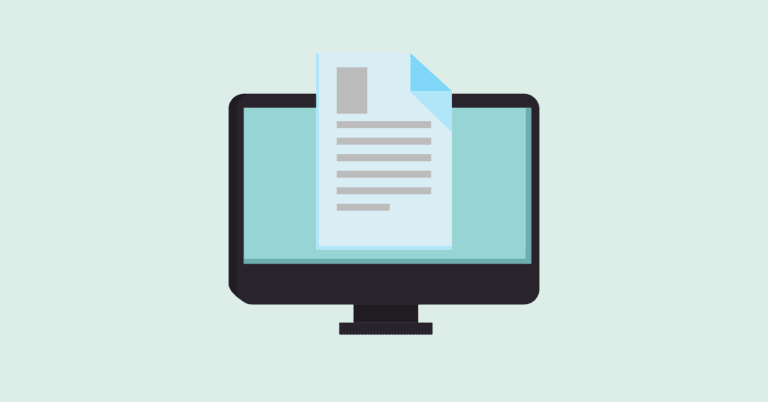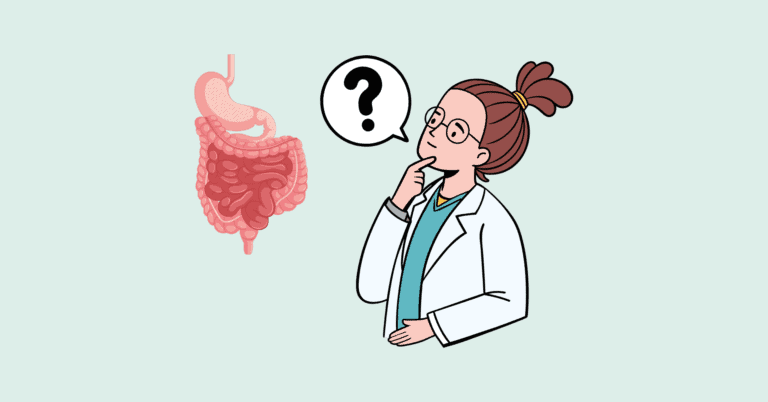Plötzlich zeigt der Vaterschaftstest: Das Kind ist nicht vom rechtlichen Vater. Was in Reality-Shows oder Promi-Schlagzeilen regelmäßig für Drama sorgt, passiert auch im echten Leben. Zweifel an der eigenen Vaterschaft können Beziehungen zerstören und haben oft gravierende rechtliche Folgen. Wer glaubt, nicht der biologische Vater zu sein, kann unter bestimmten Voraussetzungen die Vaterschaft aberkennen lassen. Erfahre mehr in diesem Artikel.
Wir bei legalnerd erklären Jura einfach und verständlich. Du willst mehr? Abonniere unseren wöchentlichen kostenlosen Newsletter oder folge uns auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!
Wir bei legalnerd erklären Jura einfach und verständlich. Du willst mehr? Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, höre in unseren Podcast rein oder folge uns auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!
Das Wichtigste in Kürze
✅ Nicht jeder darf die Vaterschaft anfechten. Nur der rechtliche Vater, die Mutter, das Kind oder in Ausnahmefällen der biologische Vater können eine Anfechtung einleiten.
✅ Es gibt eine feste Frist. Die Vaterschaft kann nur innerhalb von 2 Jahren angefochten werden – gerechnet ab dem Zeitpunkt, an dem Zweifel an der biologischen Abstammung bekannt wurden.
✅ Ein DNA-Test ist oft entscheidend. Das Gericht kann ein Gutachten anordnen, um die biologische Abstammung zu klären. Private Tests müssen mit Zustimmung aller Beteiligten erfolgen.
✅ Das Verfahren läuft über das Familiengericht. Die Vaterschaft wird nicht einfach durch eine Erklärung aufgehoben. Nur ein gerichtliches Urteil kann die rechtliche Vaterschaft beenden.
✅ Nach erfolgreicher Aberkennung entfallen alle Rechte und Pflichten. Das bedeutet: kein Unterhalt, kein Erbrecht, kein Sorgerecht – aber auch keine gesetzliche Verbindung mehr zum Kind.
Wer kann eine Vaterschaft aberkennen?
Nicht jeder darf eine Vaterschaft einfach anfechten. Das Gesetz gibt ganz klar vor, wer dazu berechtigt ist und wer nicht. Dabei wird zwischen dem rechtlichen und dem biologischen Vater unterschieden. Der rechtliche Vater ist der Mann, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter verheiratet ist oder der die Vaterschaft anerkannt hat (§ 1592 BGB). Er gilt vor dem Gesetz als Vater, auch wenn er nicht der leibliche Vater ist.
Diese Personen dürfen die Vaterschaft anfechten
Der rechtliche Vater selbst – wenn er Zweifel hat, dass das Kind von ihm stammt.
Die Mutter – wenn sie weiß oder vermutet, dass der rechtliche Vater nicht der biologische Vater ist.
Das Kind – vertreten durch die Mutter oder einen Vormund, meist über das Jugendamt.
Der biologische Vater – aber nur, wenn noch kein anderer Mann rechtlich als Vater gilt. Sobald die Vaterschaft anerkannt oder gerichtlich festgestellt wurde, hat der leibliche Vater in der Regel keine Möglichkeit mehr, sich einzumischen (§ 1600 Abs. 1 BGB).
Keine Anfechtung durch Dritte
Großeltern, neue Lebenspartner:innen oder andere Personen haben keine Möglichkeit, die Vaterschaft anzufechten, selbst wenn sie Zweifel haben. Das schützt die Familie vor unnötigen Eingriffen von außen.
Gerade wenn das Kind minderjährig ist, spielt das Jugendamt eine wichtige Rolle. Es kann das Kind rechtlich vertreten und die Anfechtung vor Gericht durchführen, wenn es dem Kindeswohl dient. In manchen Fällen übernimmt auch eine Verfahrenspflegerin oder ein Verfahrenspfleger diese Aufgabe.
Nur weil jemand also denkt, er sei nicht der Vater, reicht das für eine erfolgreiche Anfechtung nicht aus. Es gelten klare rechtliche Voraussetzungen, vor allem was Fristen und Beweise angeht.
Unsere Plattform dient der rechtlichen Aufklärung. Dies ersetzt jedoch keine Rechtsberatung durch Expert:innen, die wir gerne vermitteln. Mit dem Ausfüllen des Formulars willigst du in diese Datenverarbeitung ein. Deine Daten werden rechtskonform verarbeitet und können jederzeit auf Anfrage gelöscht werden. Mehr Infos dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Vaterschaft aberkennen: Das sind die Voraussetzungen
Wenn du die Vaterschaft anfechten willst, musst du mehr mitbringen als nur ein schlechtes Bauchgefühl. Die Gerichte prüfen genau, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Vaterschaftsanfechtung erfüllt sind. Und: Es gibt enge Fristen, die du unbedingt einhalten musst.
Die wichtigste Voraussetzung ist, dass du ernsthaft bezweifelst, der leibliche Vater des Kindes zu sein und dass du dafür konkrete Anhaltspunkte hast. Das können zum Beispiel Aussagen der Mutter, medizinische Gründe oder sogar Äußerlichkeiten des Kindes sein. Reine Spekulationen reichen nicht. Du kannst auch ein privates Abstammungsgutachten erstellen, bevor du rechtlich aktiv wirst.
Keine Anfechtung bei vorherigem Wissen oder künstlicher Befruchtung
Hast du als rechtlicher Vater in eine künstliche Befruchtung mit Fremdsperma eingewilligt, kannst du die Vaterschaft später nicht mehr anfechten. Das gilt auch dann, wenn du nicht der biologische Vater bist (§ 1600 Abs. 4 BGB). Das Gesetz schützt in diesem Fall die geplante Elternschaft und gibt dem Kind Stabilität.
Wenn du schon bei der Geburt wusstest oder zumindest sicher hättest wissen können, dass du nicht der biologische Vater bist, kannst du die Vaterschaft später unter Umständen nicht mehr anfechten. Der Schutz des Kindes und seiner sozialen Familie steht im Vordergrund.
Zwei-Jahres-Frist nicht verpassen
Du hast für die Anfechtung nur 2 Jahre Zeit. Die Frist beginnt ab dem Moment, in dem du von Umständen erfährst, die gegen deine Vaterschaft sprechen (§ 1600b BGB). Das kann zum Beispiel ein Gespräch mit der Mutter sein oder ein privater DNA-Test. Wer diese Frist verpasst, bleibt rechtlich Vater, selbst wenn er es biologisch nicht ist.
Ohne Nachweis wird das Gericht jedoch keine Vaterschaft aufheben. In der Regel wird ein gerichtlich angeordnetes Abstammungsgutachten eingeholt, um die Frage der biologischen Abstammung zu klären. Private Tests können ein erster Schritt sein, aber sie reichen nicht für das Verfahren vor Gericht.
Wie läuft das Verfahren zur Vaterschaftsanfechtung ab?
Die Vaterschaft wird nicht einfach durch eine Erklärung aufgehoben. Wer sie anfechten will, muss vor Gericht ziehen. Dabei gelten klare gesetzliche Regeln, die für alle Beteiligten – Vater, Mutter und Kind – gelten. Ohne Urteil bleibt die rechtliche Vaterschaft bestehen.
Zuständig ist das Familiengericht
Das Verfahren wird beim Familiengericht eingeleitet. Zuständig ist das Gericht am Wohnort des Kindes. Dort wird die sogenannte Vaterschaftsanfechtungsklage eingereicht. Ratsam ist eine fachkundige Unterstützung durch eine Anwältin oder einen Anwalt für Familienrecht – schon aus formalen Gründen.
Im Verfahren sind nicht nur der Kläger und das Kind beteiligt. Auch die Mutter muss gehört werden. Wenn das Kind minderjährig ist, wird es durch das Jugendamt oder eine:n Verfahrenspfleger:in vertreten. Ziel ist es, die Interessen aller Seiten zu schützen – besonders die des Kindes.
Gericht ordnet DNA-Test an
Das Familiengericht kann ein Abstammungsgutachten anordnen, wenn Zweifel bestehen. Dafür müssen alle Beteiligten ihre DNA-Proben abgeben. Der Test erfolgt nur, wenn die Voraussetzungen für eine Anfechtung überhaupt erfüllt sind, also z. B. die Frist gewahrt ist und ernsthafte Zweifel vorliegen. Das Ergebnis ist meist eindeutig: Es zeigt mit hoher Wahrscheinlichkeit, ob der Kläger der biologische Vater ist oder nicht.
Kosten und Dauer des Verfahrens
Ein Vaterschaftsanfechtungsverfahren kann sich über mehrere Monate ziehen – je nachdem, wie schnell das Gutachten erstellt wird und ob alle Beteiligten mitwirken. Verzögerungen entstehen oft, wenn z. B. die Mutter oder das Kind nicht kooperieren. Dann kann das Gericht sogar Zwangsgelder verhängen.
Die Kosten richten sich nach dem Verfahrenswert. Je nach Umfang und Gutachten kannst du mit mehreren hundert bis über tausend Euro rechnen. Wer sich das nicht leisten kann, kann beim Gericht Verfahrenskostenhilfe beantragen. Dann übernimmt der Staat teilweise oder vollständig die Kosten.
Was passiert nach erfolgreicher Aberkennung?
Wenn das Gericht feststellt, dass der rechtliche Vater nicht der biologische Vater ist, hat das weitreichende Folgen für alle Beteiligten. Die rechtliche Vaterschaft wird aufgehoben, und damit ändern sich auch Unterhalt, Sorgerecht und weitere Pflichten.
Vaterschaft wird vollständig aufgehoben
Mit dem Urteil ist die Vaterschaft rechtlich nicht mehr existent. Das bedeutet: Der Mann verliert alle Rechte und Pflichten, die mit der Vaterschaft verbunden sind. Das gilt sowohl für das Sorgerecht als auch für das Umgangsrecht.
Eine Ausnahme gibt es nur, wenn es bereits eine enge soziale Bindung zum Kind gibt. Dann kann der Kontakt in seltenen Fällen bestehen bleiben – etwa über ein Umgangsrecht „ähnlich wie bei einem sozialen Vater“.
Kein Unterhalt und Erbrecht mehr
Nach der erfolgreichen Aberkennung muss der ehemalige Vater keinen Unterhalt mehr zahlen. Auch bereits gezahlter Unterhalt kann unter Umständen zurückgefordert werden, das ist aber kompliziert und nur in besonderen Fällen möglich. In der Regel endet die Unterhaltspflicht mit dem gerichtlichen Urteil.
Das Kind verliert automatisch jeden Erbanspruch gegenüber dem bisherigen Vater. Umgekehrt hat auch der Vater keine erbrechtlichen Ansprüche mehr gegenüber dem Kind. Es besteht dann keinerlei gesetzliche Verwandtschaft mehr, so als ob die Vaterschaft nie bestanden hätte.
Geburtenregister wird geändert
Das Urteil wird an das Standesamt weitergeleitet. Dort wird die Vaterschaft im Geburtenregister gelöscht oder geändert. Es kann dann ein anderer Mann als Vater eingetragen werden, zum Beispiel der biologische Vater, wenn dieser die Vaterschaft anerkennt oder sie gerichtlich festgestellt wird.
Auch wenn es juristisch klar geregelt ist: Für das Kind kann eine Aberkennung emotional belastend sein. Plötzlich fällt eine Bezugsperson weg, und es entsteht oft Unsicherheit über die eigene Identität. Deshalb ist es wichtig, auch die menschliche Seite im Blick zu behalten. In manchen Fällen kann psychologische Unterstützung sinnvoll sein, zum Beispiel durch eine Familienberatungsstelle oder das Jugendamt.
Ich möchte die Vaterschaft aberkennen lassen: Was tun?
Die folgenden Infos dienen nur als erste Orientierung. Sie ersetzen keine Rechtsberatung durch spezialisierte Anwält:innen. Für eine verbindliche Auskunft solltest du dich immer direkt von Expert:innen beraten lassen, denn unsere Infos können unvollständig oder nicht aktuell sein.
Wenn du das Gefühl hast, nicht der biologische Vater eines Kindes zu sein, solltest du überlegt handeln. Gleichzeitig ist nicht zu vergessen, dass Fristen laufen und du kannst deine Rechte verlieren, wenn du zu lange wartest.
Hol dir frühzeitig rechtlichen Beistand
Bevor du irgendetwas unternimmst, solltest du dich an eine Anwältin oder einen Anwalt für Familienrecht wenden. Sie prüfen deinen Fall, klären mit dir, ob eine Anfechtung überhaupt möglich ist, und kümmern sich um die nötigen Schritte beim Familiengericht. Ohne juristische Unterstützung drohen Formfehler und die können das ganze Verfahren kippen.
Wichtige Fristen
Du hast nur 2 Jahre Zeit, um die Vaterschaft anzufechten (§ 1600b BGB). Diese Frist beginnt ab dem Moment, in dem du einen konkreten Hinweis bekommst, dass du nicht der Vater bist. Wenn du z. B. von der Mutter erfährst, dass es einen anderen möglichen Vater gibt, solltest du sofort handeln.
DNA-Test: privat oder gerichtlich?
Ein privater Abstammungstest kann dir erste Gewissheit geben, allerdings darfst du ihn nicht ohne Einwilligung der Mutter und des Kindes durchführen (§ 1598a BGB). Ohne Zustimmung ist der Test unzulässig und vor Gericht nicht verwertbar.
Ein offizieller DNA-Test wird später meist vom Gericht angeordnet, aber du kannst ihn auch über das Jugendamt oder mit Zustimmung aller Beteiligten schon vorher beantragen.
Beweise und Unterlagen sammeln
Je besser du deine Zweifel belegen kannst, desto stärker ist deine Position im Verfahren. Halte alles fest, was für dein Anliegen wichtig sein könnte: Nachrichten, Aussagen der Mutter, medizinische Unterlagen oder Fotos. Auch wenn das Gericht später ein DNA-Gutachten einholt, deine Begründung muss stichhaltig sein.
Auch biologische Väter haben Möglichkeiten
Wenn du glaubst, dass du der biologische Vater bist, aber nicht als rechtlicher Vater giltst, hast du unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, selbst die Vaterschaft festzustellen. Aber auch hier gelten Fristen und Bedingungen, z. B. darf nicht bereits ein anderer Mann rechtlich als Vater anerkannt oder gerichtlich festgestellt sein.
Fazit
Die Vaterschaft aberkennen zu lassen, ist ein rechtlich und emotional schwerwiegender Schritt. Er betrifft nicht nur den Vater, sondern auch das Kind und die Mutter – oft mit Folgen für das ganze Leben. Das Gesetz erlaubt die Anfechtung nur unter engen Voraussetzungen und innerhalb klarer Fristen. Wer zweifelt, kann sich rechtzeitig anwaltlich über seine Möglichkeiten beraten lassen.