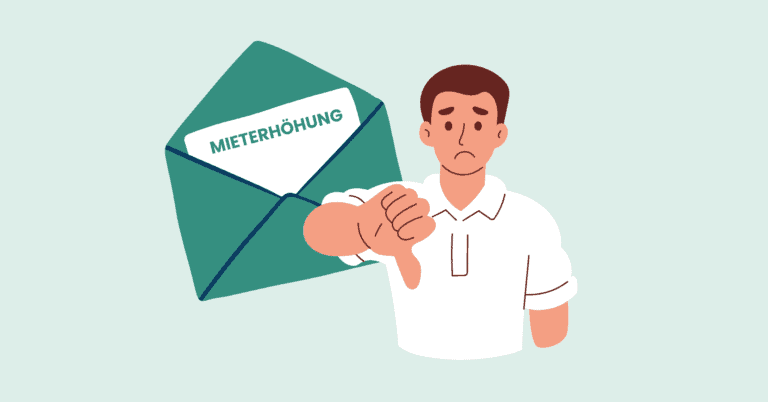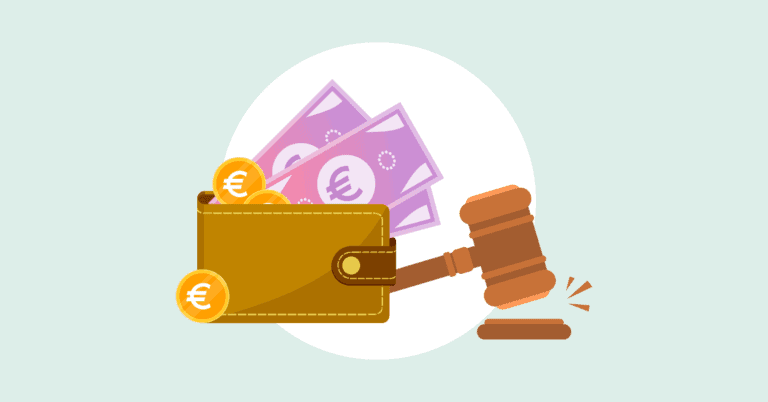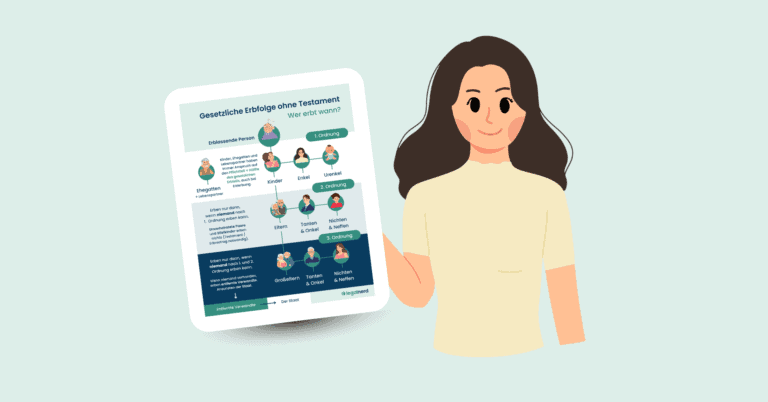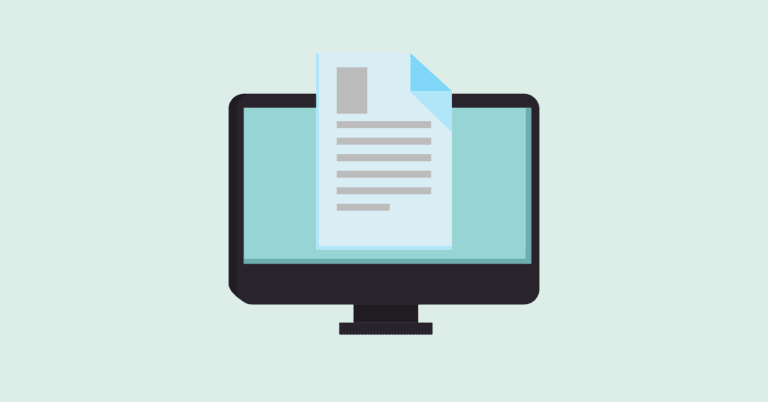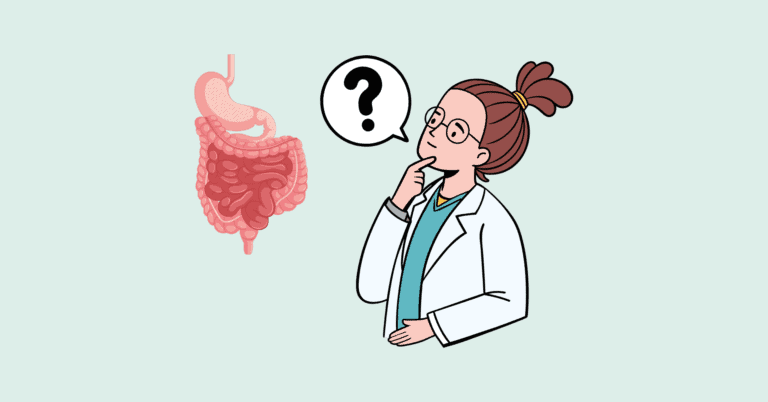In vielen Städten steigen die Mieten Jahr für Jahr. Für langjährige Mieter:innen ist das oft ein Schock: Jahrzehntelang im selben Zuhause gelebt, die Nachbarschaft mit aufgebaut und plötzlich soll man deutlich mehr Miete zahlen? Die Mieterhöhung langjähriger Mieter ist zurecht ein viel gesuchtes Thema im Internet. Gerade ältere Menschen oder Familien mit festem Wohnumfeld fühlen sich dadurch verunsichert. Sie fragen sich: Ist das rechtens? Gibt es besonderen Schutz für treue Mieter:innen? Und wie lassen sich Erhöhungen prüfen, ohne direkt in einen Mietstreit zu geraten? Erfahre mehr in diesem Artikel.
Wir bei legalnerd erklären Jura einfach und verständlich. Du willst mehr? Abonniere unseren wöchentlichen kostenlosen Newsletter oder folge uns auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!
Das Wichtigste in Kürze
✅ Auch bei einer Mieterhöhung langjähriger Mieter gelten die allgemeinen Regeln des BGB. Eine lange Mietdauer allein schützt nicht vor einer Anpassung.
✅ Die Kappungsgrenze begrenzt Erhöhungen auf maximal 20 % in 3 Jahren, in angespannten Wohnungsmärkten sogar auf 15 %.
✅ Jede Mieterhöhung muss sich an der ortsüblichen Vergleichsmiete orientieren und schriftlich sowie nachvollziehbar begründet werden.
✅ Nach Zugang des Erhöhungsverlangens bleibt eine Überlegungsfrist von 2 Monaten, in der Mieter:innen prüfen können, ob sie zustimmen.
✅ Wer Zweifel hat, sollte das Schreiben von einem Mieterverein oder einer Anwältin bzw. einem Anwalt für Mietrecht prüfen lassen, um unzulässige Forderungen abzuwehren.
Wann ist eine Mieterhöhung zulässig?
Damit eine Mieterhöhung wirksam ist, braucht sie immer eine gesetzliche Grundlage. Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) sind verschiedene Möglichkeiten geregelt, wie Vermieter:innen die Miete anpassen dürfen.
Vergleichsmiete
Die häufigste Variante ist die Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete (§ 558 BGB). Dabei wird geschaut, welche Mieten in der Nachbarschaft für vergleichbare Wohnungen gezahlt werden. Als Begründung dürfen ein Mietspiegel, 3 konkrete Vergleichswohnungen oder ein Gutachten herangezogen werden. Wichtig: Die bisherige Miete darf dabei nur schrittweise erhöht werden und muss im Rahmen der Kappungsgrenze bleiben.
Modernisierung
Wenn die Wohnung modernisiert wurde, etwa durch eine neue Heizung oder bessere Wärmedämmung, darf die Vermieterin oder der Vermieter die Kosten teilweise auf die Miete umlegen (§ 559 BGB). Langjährige Mieter:innen trifft das besonders häufig, wenn alte Häuser auf den neuesten Stand gebracht werden. Maximal dürfen 8 % der Modernisierungskosten pro Jahr auf die Miete aufgeschlagen werden.
Gestiegene Betriebskosten
Auch die Betriebskosten (§ 560 BGB) können steigen – etwa durch höhere Energiepreise, Versicherungen oder Müllgebühren. Diese Kosten dürfen an die Mieter:innen weitergegeben werden, wenn eine Betriebskostenumlage im Mietvertrag vereinbart ist. Hier handelt es sich nicht um eine klassische Mieterhöhung, sondern um eine Anpassung der Nebenkosten. Wenn du Zweifel hast, kannst du deinen Mietvertrag prüfen lassen.
Erfahre in einem anderen Artikel von uns, wie oft der Vermieter die Miete erhöhen darf.
Unsere Plattform dient der rechtlichen Aufklärung. Dies ersetzt jedoch keine Rechtsberatung durch Expert:innen, die wir gerne vermitteln. Mit dem Ausfüllen des Formulars willigst du in diese Datenverarbeitung ein. Deine Daten werden rechtskonform verarbeitet und können jederzeit auf Anfrage gelöscht werden. Mehr Infos dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Mieterhöhung als langjähriger Mieter: Das musst du wissen
Viele fragen sich, ob es für langjährige Mietverhältnisse einen besonderen Schutz gibt. Schließlich bedeutet eine lange Mietdauer oft tiefe Verwurzelung im Wohnumfeld und eine gewachsene Bindung zur Wohnung. Rein rechtlich gibt es aber keine Sonderregelung allein aufgrund der Mietdauer.
Ob jemand seit 3 oder seit 30 Jahren in einer Wohnung lebt: Die gesetzlichen Grundlagen für eine Mieterhöhung sind identisch. Der Vermieter oder die Vermieterin darf sich immer nur auf die im Gesetz vorgesehenen Möglichkeiten berufen.
Gerade für langjährige Mietverhältnisse ist die Kappungsgrenze (§ 558 Abs. 3 BGB) wichtig. Sie legt fest, dass die Miete innerhalb von 3 Jahren höchstens um 20 % steigen darf. In angespannten Wohnungsmärkten, etwa in vielen Großstädten, liegt die Grenze sogar bei 15 %. Dieser Mechanismus schützt alle Mieter:innen gleichermaßen vor übermäßigen Sprüngen.
Sozialklausel bei Kündigungen
Ein weit verbreitetes Missverständnis: Die Sozialklausel (§ 574 BGB) schützt zwar langjährige Mieter:innen, wenn eine Kündigung ausgesprochen wird, nicht aber direkt vor Mieterhöhungen. Das bedeutet: Auch nach Jahrzehnten im selben Zuhause muss eine Mieterhöhung akzeptiert werden, wenn sie formal und inhaltlich korrekt ist.
In Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt greift zusätzlich die Mietpreisbremse (§ 556d BGB). Sie betrifft aber in erster Linie Neuvermietungen, nicht bestehende Verträge. Für langjährige Mieter:innen spielt sie also nur eine untergeordnete Rolle.
Wann eine Mieterhöhung unzulässig ist
Auch wenn die Miete grundsätzlich angepasst werden darf, setzt das Gesetz klare Grenzen. Diese Regeln sollen verhindern, dass Vermieter:innen willkürlich oder übermäßig erhöhen.
Kappungsgrenze
Die wichtigste Schranke ist die Kappungsgrenze (§ 558 Abs. 3 BGB). Innerhalb von 3 Jahren darf die Miete höchstens um 20 % steigen. In vielen Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt gilt sogar eine Grenze von 15 %. Damit bleibt die Belastung für Mieter:innen überschaubar, selbst wenn die Vergleichsmieten deutlich höher liegen.
Ortsübliche Vergleichsmiete
Eine Mieterhöhung nach § 558 BGB ist nur bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete erlaubt. Diese wird durch den Mietspiegel, Vergleichswohnungen oder ein Sachverständigengutachten ermittelt. Liegt die geforderte Miete darüber, ist die Erhöhung unzulässig.
Formvorschriften und Begründung
Ein Mieterhöhungsverlangen muss schriftlich erfolgen und nachvollziehbar begründet sein (§ 558a BGB). Es reicht also nicht, einfach einen höheren Betrag zu nennen. Die Vermieterin oder der Vermieter muss genau darlegen, warum die Anpassung gerechtfertigt ist, zum Beispiel durch Angabe von Mietspiegel oder Vergleichswohnungen.
Sperrfrist
Wichtig für langjährige Mietverhältnisse: Nach einer Mieterhöhung muss mindestens ein Jahr vergehen, bevor die nächste Erhöhung nach § 558 BGB verlangt werden darf (§ 558 Abs. 1 BGB). So wird verhindert, dass ständig neue Forderungen gestellt werden.
Mieterhöhung: Was langjährige Mieter prüfen sollten
Eine Mieterhöhung ist nicht automatisch wirksam. Auch langjährige Mieter:innen haben die Möglichkeit, den Brief genau zu prüfen und Fehler zu entdecken.
Zuerst sollte kontrolliert werden, ob die geforderte Miete wirklich zur ortsüblichen Vergleichsmiete passt. Ein Blick in den örtlichen Mietspiegel zeigt oft schnell, ob die Angaben realistisch sind. Wer unsicher ist, kann zusätzlich Vergleichswohnungen oder ein Gutachten heranziehen.
Wurde die Miete in den letzten 3 Jahren bereits erhöht? Dann lohnt es sich, genau zu rechnen. Denn die Kappungsgrenze (§ 558 Abs. 3 BGB) gilt unabhängig davon, ob die Mieterhöhung begründet wäre. Wird die Grenze überschritten, ist das Verlangen unzulässig. Erfahre mehr zur zulässigen Anzahl der Mieterhöhung.
Fehlt eine ordentliche Begründung oder wurde die Erhöhung nicht schriftlich mitgeteilt, ist sie formell unwirksam. Gerade langjährige Mieter:innen haben hier gute Chancen, eine unzureichende Begründung aufzudecken.
Bei Modernisierungen ist wichtig: Nur bestimmte Kosten dürfen auf die Miete umgelegt werden (§ 559 BGB). Reparaturen oder reine Instandhaltungen sind ausgeschlossen. Hier wird oft fehlerhaft gerechnet.
Nicht jede Erhöhung ist eine klassische Mieterhöhung. Betriebskostenanpassungen (§ 560 BGB) betreffen nur die Nebenkosten. Sie dürfen nur dann verlangt werden, wenn das auch im Mietvertrag vereinbart wurde.
Was tun bei unzulässiger Mieterhöhung?
Die folgenden Ausführungen dienen als erste Orientierung und ersetzen keine individuelle Rechtsberatung durch eine Anwältin oder einen Anwalt für Mietrecht. Da sich Gesetze und Rechtsprechung ändern können, sind unsere Informationen möglicherweise nicht mehr aktuell oder vollständig. Für eine verbindliche Einschätzung solltest du deine Unterlagen von Expert:innen prüfen lassen.
Eine Mieterhöhung tritt nicht automatisch in Kraft. Sie wird erst wirksam, wenn du zustimmst. Deshalb solltest du das Schreiben genau prüfen, bevor du eine Entscheidung triffst.
Erst prüfen, dann reagieren
Überlege dir in Ruhe, ob die verlangte Mieterhöhung korrekt ist. Achte darauf, ob die ortsübliche Vergleichsmiete stimmt, die Kappungsgrenze eingehalten wurde und die Begründung nachvollziehbar ist.
Zustimmung verweigern
Wenn die Erhöhung fehlerhaft oder unzulässig ist, darfst du die Zustimmung einfach verweigern. Ohne deine Zustimmung bleibt es bei der bisherigen Miete. Die Vermieterseite müsste dann klagen, um die Erhöhung durchzusetzen.
Unterstützung holen
Gerade bei komplexen Fällen ist es sinnvoll, Hilfe zu suchen. Ein Mieterverein oder eine Anwältin bzw. ein Anwalt für Mietrecht kann die Unterlagen prüfen und dir sagen, ob die Forderung rechtmäßig ist.
Gerichtliche Klärung
Kommt es zum Streit, entscheidet das Amtsgericht, ob die Mieterhöhung wirksam ist. Für langjährige Mieter:innen bedeutet das zwar Aufwand, gleichzeitig besteht aber die Chance, unrechtmäßige Forderungen abzuwehren.
Fristen beachten
Du hast nach Zugang des Mieterhöhungsverlangens 2 volle Kalendermonate Zeit, um zu reagieren (§ 558b Abs. 2 BGB). Innerhalb dieser Frist solltest du dich entscheiden, ob du zustimmst oder ablehnst.
Fazit
Eine Mieterhöhung langjähriger Mieter ist rechtlich möglich, solange sie die gesetzlichen Vorgaben einhält. Auch wer seit vielen Jahren im selben Zuhause lebt, hat keine Sonderrechte allein wegen der Mietdauer. Entscheidend sind die Kappungsgrenze, die ortsübliche Vergleichsmiete und eine ordnungsgemäße Begründung. Für Mieter:innen lohnt es sich, jedes Erhöhungsverlangen genau zu prüfen. Oft zeigen sich Fehler in der Berechnung oder Form. Wer unsicher ist, sollte Unterstützung durch einen Mieterverein oder eine Anwältin bzw. einen Anwalt für Mietrecht in Anspruch nehmen, um die eigenen Rechte zu sichern.