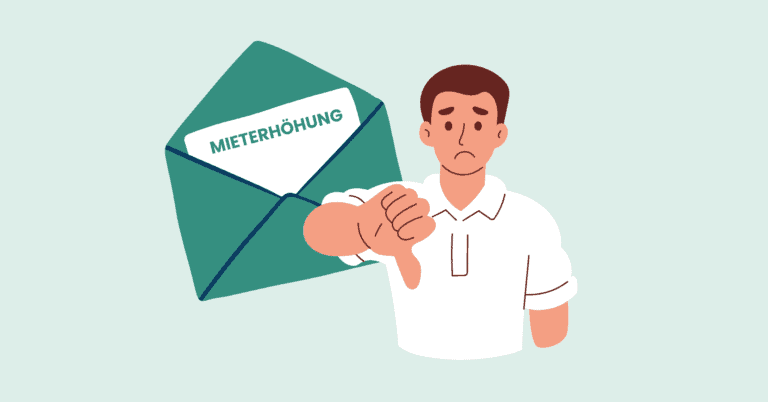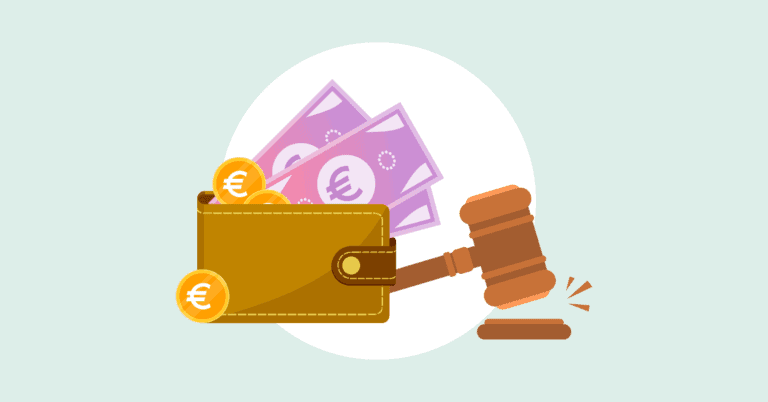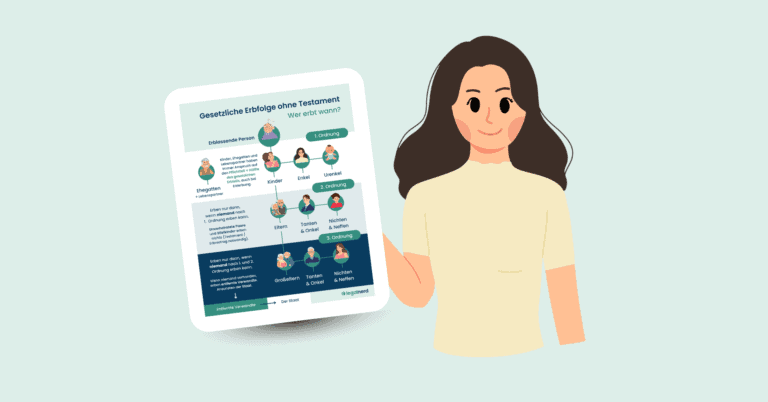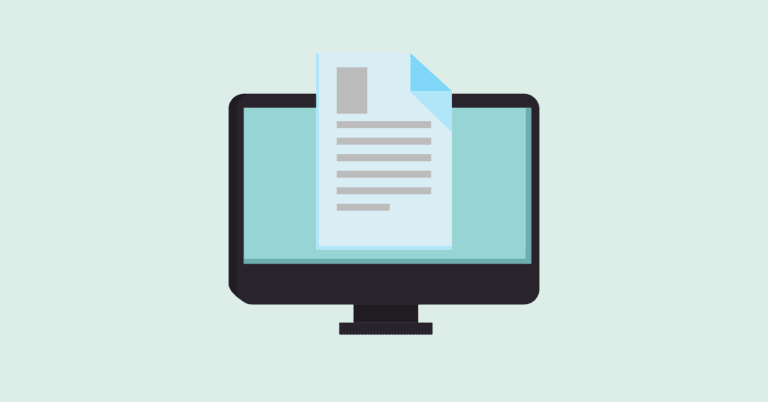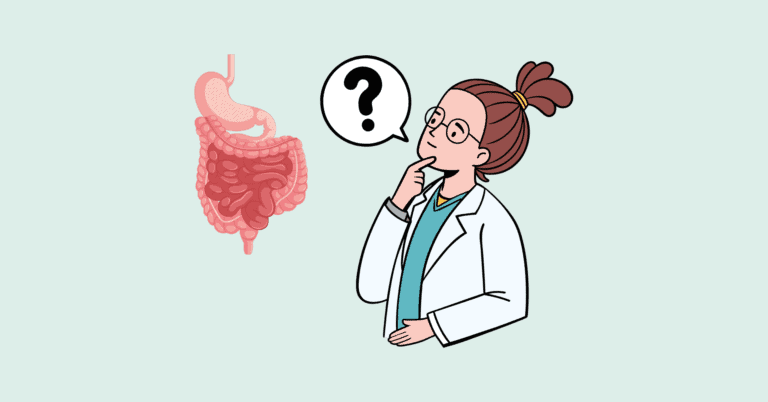Deine komplette Krankengeschichte – von verschriebenen Medikamenten über Diagnosen bis hin zu Arztberichten – liegt digital an einem Ort. Genau das verspricht die elektronische Patientenakte. Nachteile zeigen sich aber vor allem dann, wenn etwas schiefgeht. Immer mehr Menschen sind unsicher, ob ihre Krankenkassen oder Ärzt:innen nicht zu viel Einblick in ihr persönliches Leben bekommen. Für manche ist die ePA ein Fortschritt, für andere eine große Gefahr. Wir schauen uns das einmal genauer an.
Wir bei legalnerd erklären Jura einfach und verständlich. Du willst mehr? Abonniere unseren wöchentlichen kostenlosen Newsletter oder folge uns auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!
Das Wichtigste in Kürze
✅ Die elektronische Patientenakte birgt Risiken für den Datenschutz, bietet aber im Vergleich zu Papierakten mehr Sicherheit und Nachvollziehbarkeit.
✅ Technische Probleme können ein Nachteil sein, langfristig führt die ePA jedoch zu mehr Effizienz und weniger verlorenen Daten.
✅ Manche Patient:innen fühlen sich kontrolliert, gleichzeitig ermöglicht die Akte aber erstmals Transparenz über gespeicherte Informationen und Zugriffe.
✅ Sorgen vor Missbrauch bestehen weiterhin. Rechtlich ist der Zugriff streng begrenzt und zweckgebunden.
✅ Ungleichheit beim Zugang bleibt ein Nachteil. Benutzerfreundliche Apps und digitale Unterstützung schaffen hier mehr Möglichkeiten.
Kontrollverlust und Datenmissbrauch bei der elektronischen Patientenakte?
Ein häufig genannter Kritikpunkt ist das Gefühl, die Kontrolle über die eigenen Gesundheitsdaten zu verlieren. Viele Patient:innen befürchten, dass Ärzt:innen oder Krankenkassen mehr Einblick erhalten, als sie möchten. Zwar gibt es Möglichkeiten, Zugriffsrechte individuell einzustellen, doch diese Funktionen sind oft kompliziert und für Laien schwer verständlich.
Positiv ist jedoch, dass du mit der ePA erstmals überhaupt eine transparente Übersicht bekommst. Du kannst nachvollziehen, welche Ärzt:innen Daten hochgeladen haben und wer Zugriff hatte. Damit steigt deine Selbstbestimmung im Vergleich zu Papierakten, die in Praxen und Kliniken oft unbemerkt eingesehen werden konnten. Mit ein wenig Einarbeitung lässt sich die elektronische Patientenakte also aktiv steuern. Erfahre mehr darüber, wie du deine Krankenakte anfordern kannst.
Kritiker:innen befürchten auch, dass Krankenkassen oder Dritte die Daten nutzen, um zum Beispiel Kosten zu sparen oder Versicherungsbedingungen zu verschärfen. Auch die Angst, dass Arbeitgeber indirekt Einblicke bekommen, ist verbreitet. Solche Szenarien wirken beunruhigend, weil es um sehr private Informationen geht.
Der Vorteil: Nach geltendem Recht ist ein solcher Missbrauch ausdrücklich verboten. Die Nutzung ist streng zweckgebunden, das heißt: Die Daten dürfen nur für die medizinische Versorgung genutzt werden (§ 341 Abs. 6 SGB V). Krankenkassen oder Arbeitgeber:innen haben keinen Zugriff. Wer die Daten trotzdem missbraucht, macht sich strafbar. Die ePA ist damit rechtlich besser abgesichert als viele andere digitale Plattformen, die persönliche Daten speichern.
Unsere Plattform dient der rechtlichen Aufklärung. Dies ersetzt jedoch keine Rechtsberatung durch Expert:innen, die wir gerne vermitteln. Mit dem Ausfüllen des Formulars willigst du in diese Datenverarbeitung ein. Deine Daten werden rechtskonform verarbeitet und können jederzeit auf Anfrage gelöscht werden. Mehr Infos dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Elektronische Patientenakte: Nachteile beim Datenschutz
Die elektronische Patientenakte enthält hochsensible Informationen – von Vorerkrankungen über psychische Diagnosen bis hin zu genetischen Daten. Genau diese Daten sind ein attraktives Ziel für Hackerangriffe. Schon ein kleiner Sicherheitsvorfall kann für Betroffene schwerwiegende Folgen haben, etwa wenn vertrauliche Gesundheitsinformationen öffentlich werden oder in die falschen Hände geraten.
Auch wenn die Krankenkassen und die Betreiber:innen hohe Sicherheitsstandards einhalten müssen, gibt es keine hundertprozentige Garantie. Angriffe auf Krankenhäuser in Deutschland haben gezeigt, dass selbst modernste Systeme verwundbar sind. Hinzu kommen Risiken durch technische Fehler, etwa wenn Zugriffsrechte falsch vergeben werden.
Auf der anderen Seite sorgt gerade die gesetzliche Grundlage für hohe Sicherheitsstandards. Laut § 341 SGB V ist der Zugriff streng geregelt, und die DSGVO schützt Patientendaten besonders. Im Vergleich zu Papierakten bietet die ePA sogar mehr Sicherheit: Während Unterlagen in einer Praxis verlegt oder entwendet werden können, sind digitale Akten verschlüsselt und protokolliert. Jede Abfrage hinterlässt Spuren, sodass Missbrauch leichter nachweisbar ist.
Ein weiteres Problem: Viele Menschen verstehen nicht, welche Daten gespeichert werden und wer darauf Zugriff hat. Das führt zu einem Gefühl von Kontrollverlust – gerade bei einem Thema, das so privat ist wie die eigene Gesundheit.
Nachteile der elektronischen Patientenakte durch technische Probleme
Ein weiteres Risiko der elektronischen Patientenakte sind technische Störungen und Hürden bei der Nutzung. Viele Praxen und Krankenhäuser arbeiten noch nicht reibungslos mit dem System. Das führt dazu, dass Daten nicht immer korrekt hochgeladen oder abgerufen werden. Auch die Apps der Krankenkassen, über die du deine Akte verwaltest, gelten oft als kompliziert und fehleranfällig.
Gerade wenn du im Notfall schnelle medizinische Hilfe brauchst, kann es problematisch sein, wenn Ärzt:innen nicht sofort Zugriff auf deine Daten haben. Eine instabile Internetverbindung oder eine überlastete Plattform reichen schon aus, um Verzögerungen zu verursachen.
Hinzu kommt: Die Bedienung ist nicht für alle gleich einfach. Besonders ältere Menschen oder Patient:innen ohne Smartphone oder Computer haben Schwierigkeiten, ihre Akte selbst zu verwalten. Dadurch entsteht ein Ungleichgewicht beim Zugang zu wichtigen Gesundheitsinformationen.
Der Vorteil liegt jedoch in der langfristigen Entwicklung: Einmal etabliert, ermöglicht die elektronische Patientenakte, dass alle wichtigen Informationen an einem Ort gebündelt sind. Untersuchungen müssen nicht doppelt gemacht werden, Befunde gehen nicht mehr verloren, und Ärzt:innen können Behandlungen schneller abstimmen. So entstehen trotz anfänglicher Störungen langfristig mehr Effizienz und weniger Fehler im Gesundheitswesen.
Doppelte oder fehlende Erfassung von Daten in der ePA
Technische Probleme könnten dazu führen, dass Daten doppelt oder gar nicht erfasst werden. Wenn wichtige Befunde fehlen, besteht die Gefahr von Fehldiagnosen oder falschen Behandlungen. Für dich als Patient:in bedeutet das im schlimmsten Fall ein höheres Risiko für Fehler in der Versorgung. Im besten Fall (und dieser ist wahrscheinlich der Standardfall) können die Daten aber problemlos nachgetragen oder korrigiert werden. Erfahre mehr dazu in unserem Beitrag zum Thema: Diagnose aus Krankenakte löschen lassen.
Der große Vorteil ist also: Mit der ePA hast du selbst die Möglichkeit, deine Daten im Blick zu behalten. Du kannst Einträge prüfen, ergänzen oder löschen lassen, wenn dir etwas auffällt. Im Gegensatz zur klassischen Papierakte, die in einer Praxis liegt und von dir kaum kontrolliert werden kann, gibt dir die elektronische Patientenakte damit mehr Transparenz. Außerdem sinkt langfristig das Risiko, dass Unterlagen ganz verschwinden oder beim Arztwechsel verloren gehen. Erfahre mehr zur Einsicht in die Patientenakte.
Elektronische Patientenakte: Nachteile durch ungleichen Zugang?
Nicht alle Menschen profitieren gleichermaßen von der elektronischen Patientenakte. Ältere Patient:innen oder Personen ohne Smartphone, Computer oder digitale Erfahrung stoßen schnell an Grenzen. Wer die Technik nicht bedienen kann, hat weniger Kontrolle über die eigenen Daten und ist stärker auf Ärzt:innen angewiesen. Das kann zu einer digitalen Ungleichheit im Gesundheitssystem führen.
Auf der positiven Seite bietet die ePA für viele andere Patient:innen einen einfacheren Zugang zu ihren Gesundheitsinformationen. Gerade jüngere oder digital affine Menschen können ihre Befunde jederzeit abrufen, Medikamente nachsehen oder Arztberichte speichern.
Außerdem arbeiten Krankenkassen daran, die Bedienung so einfach wie möglich zu gestalten – zum Beispiel durch benutzerfreundliche Apps oder Unterstützung bei der Einrichtung. Langfristig kann so auch die Gesundheitskompetenz vieler Menschen gestärkt werden. Außerdem trägt es allgemein zur viel gewünschten Digitalisierung in Deutschland bei.
Digitale Patientenakte: Rechtliche Unsicherheiten
Die elektronische Patientenakte wirft auch rechtliche Fragen auf. Was passiert, wenn Daten verloren gehen oder durch technische Fehler falsche Einträge gespeichert werden? Wer trägt die Verantwortung bei einer Datenpanne – die Krankenkasse, die behandelnde Ärztin oder der IT-Dienstleister? Solche Unsicherheiten sind bislang nicht in allen Details geklärt. Das verunsichert viele Patient:innen zusätzlich.
Auf der anderen Seite gibt es klare gesetzliche Vorgaben. Die Nutzung der ePA ist im Sozialgesetzbuch V (§ 341 SGB V) geregelt und unterliegt zusätzlich der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Damit sind die Rahmenbedingungen streng abgesteckt. Verstöße können empfindliche Strafen nach sich ziehen, was für Betroffene einen hohen Schutz bedeutet. Zudem entwickeln sich Rechtsprechung und Praxis weiter, sodass die Unsicherheiten nach und nach geklärt werden.
Fazit
Die elektronische Patientenakte bringt viele Vorteile, aber auch deutliche Risiken mit sich. Gerade beim Datenschutz, bei technischen Problemen oder rechtlichen Fragen zeigt sich, dass es noch offene Baustellen gibt. Gleichzeitig ermöglicht die ePA dir mehr Transparenz und Kontrolle als je zuvor. Sie schafft die Grundlage, dass Ärztinnen und Ärzte besser zusammenarbeiten und deine medizinische Versorgung langfristig sicherer und effizienter wird. Es bleibt also wichtig, die Nachteile im Blick zu behalten, ohne die Chancen zu übersehen.