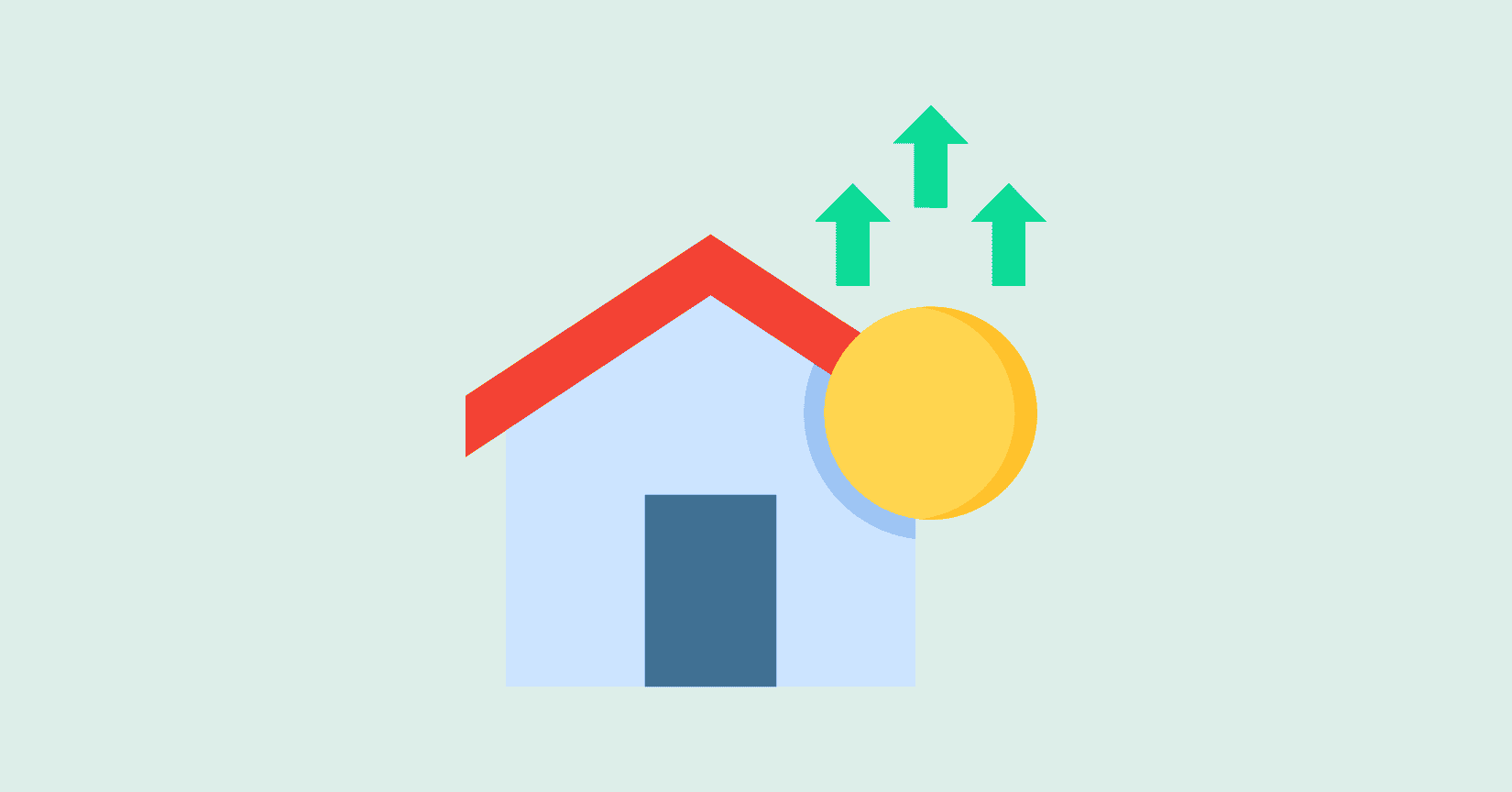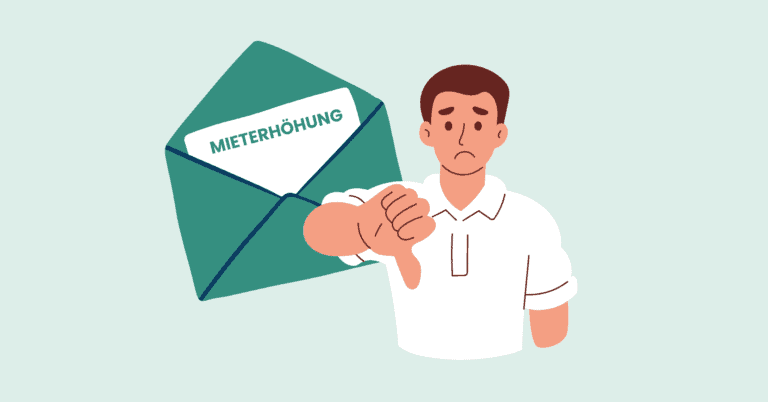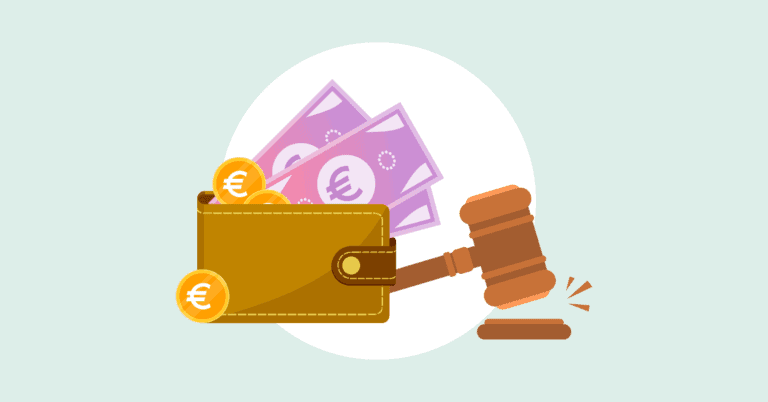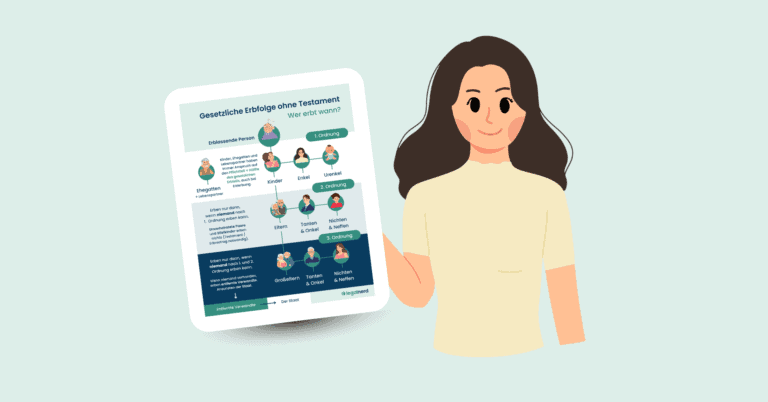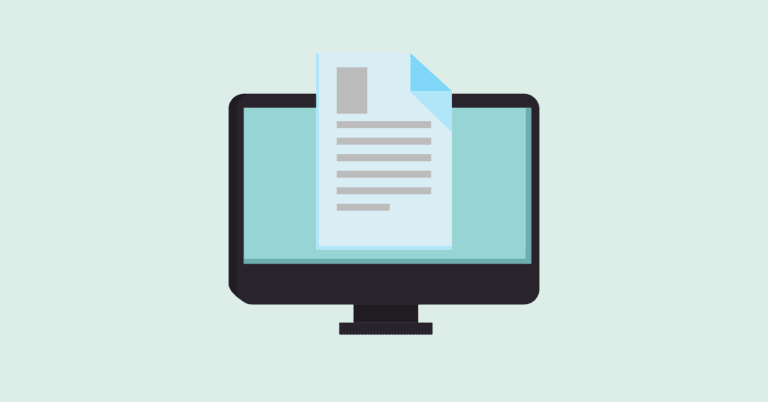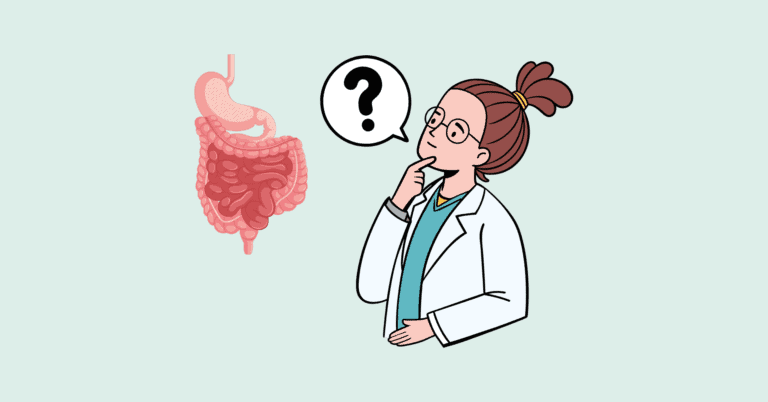Plötzlich liegt ein Brief im Briefkasten: Dein:e Vermieter:in kündigt eine Mieterhöhung an – und das schon wieder. Gerade erst hast du dich an die letzte Anpassung gewöhnt, jetzt wird’s schon wieder teurer. Besonders in Städten wie Berlin, München oder Köln fragen sich viele: Mieterhöhung – wie oft darf das eigentlich passieren? Was ist erlaubt und wo zieht das Gesetz die Grenze? Erfahre mehr in diesem Artikel.
Wir bei legalnerd erklären Jura einfach und verständlich. Du willst mehr? Abonniere unseren wöchentlichen kostenlosen Newsletter oder folge uns auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!
Wir bei legalnerd erklären Jura einfach und verständlich. Du willst mehr? Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, höre in unseren Podcast rein oder folge uns auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!
Das Wichtigste in Kürze
✅ Vermieter:innen dürfen die Miete nicht beliebig oft erhöhen. Zwischen zwei Erhöhungen muss mindestens ein Jahr liegen, wirksam wird sie frühestens nach 15 Monaten.
✅ Innerhalb von 3 Jahren darf die Miete nur um maximal 20 % steigen. In vielen Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt gilt sogar eine Grenze von 15 %.
✅ Bei Staffelmiete oder Indexmiete gelten andere Regeln: Dort kann die Miete regelmäßig steigen, ohne dass du zustimmen musst, aber auch nur einmal pro Jahr.
✅ Modernisierungen berechtigen den Vermieter oder die Vermieterin zu einer separaten Mieterhöhung, unabhängig von den sonstigen Grenzen, aber nur, wenn echte Verbesserungen vorliegen.
✅ Du musst der Mieterhöhung zustimmen, damit sie gilt. Prüfe vorher, ob sie formal korrekt ist und ob die neue Miete noch der ortsüblichen Vergleichsmiete entspricht. Lasse dich im Zweifel anwaltlich dazu beraten.
Mieterhöhung: Wie oft ist sie gesetzlich erlaubt?
Vermieter:innen dürfen die Miete nicht beliebig oft oder beliebig stark erhöhen. Das regelt das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) ziemlich klar. Entscheidend ist dabei § 558 BGB: Wenn keine Staffelmiete oder Indexmiete vereinbart wurde, darf der Vermieter oder die Vermieterin die Miete nur unter bestimmten Voraussetzungen anpassen.
Kappungsgrenze: nicht mehr als 20 % in 3 Jahren
Ein wichtiger Begriff ist hier die Kappungsgrenze. Das bedeutet: Innerhalb von 3 Jahren darf die Miete höchstens um 20 % steigen – in vielen Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt sogar nur um 15 %. Diese Grenze gilt auch dann, wenn es mehrere Mieterhöhungen in kurzer Zeit geben sollte (§ 558 Abs. 3 BGB).
Welche Städte zur „angespannten Wohnlage“ zählen, legen die Landesregierungen fest. In Berlin, Hamburg oder München gilt meist die 15 %-Grenze. Wenn du unsicher bist, kannst du das auf der Seite deines Bundeslandes nachlesen.
Mindestens ein Jahr Ruhe nach jeder Erhöhung
Zwischen zwei Mieterhöhungen muss mindestens ein Jahr Abstand liegen (§ 558 Abs. 1 Satz 2 BGB). Der Vermieter oder die Vermieterin darf dir also frühestens 12 Monate nach der letzten Erhöhung wieder eine neue Ankündigung schicken. Tatsächlich wirksam wird die neue Miete dann aber erst 15 Monate nach der letzten Erhöhung, da zusätzlich eine Ankündigungsfrist gilt (§§ 558 Abs. 1 Satz 1, 558b Abs. 1 BGB).
Was zählt eigentlich als Mieterhöhung?
Nicht jede Veränderung der monatlichen Zahlung ist gleich eine „Mieterhöhung“ im rechtlichen Sinn. Es kommt darauf an, warum die Miete steigt:
- Erhöhungen wegen Modernisierung (§ 559 BGB) zählen gesondert.
- Auch Änderungen bei den Betriebskosten oder der Indexmiete sind rechtlich eigene Kategorien.
- Nur Erhöhungen auf die ortsübliche Vergleichsmiete (§ 558 BGB) unterliegen den genannten Begrenzungen.
Wenn du einen Mietvertrag mit Staffelmiete oder Indexmiete unterschrieben hast, gelten andere Regeln. Hier richtet sich die Erhöhung nicht nach dem Ermessen des Vermieters oder der Vermieterin, sondern ist vertraglich bzw. rechnerisch festgelegt.
Unsere Plattform dient der rechtlichen Aufklärung. Dies ersetzt jedoch keine Rechtsberatung durch Expert:innen, die wir gerne vermitteln. Mit dem Ausfüllen des Formulars willigst du in diese Datenverarbeitung ein. Deine Daten werden rechtskonform verarbeitet und können jederzeit auf Anfrage gelöscht werden. Mehr Infos dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Ausnahmen bei Mieterhöhung: Wie oft bei Sonderfällen erlaubt?
Nicht jede Mieterhöhung fällt unter die Regeln des § 558 BGB. Manche Mietverträge enthalten spezielle Klauseln oder folgen anderen Modellen und dann gelten eigene Regeln. Gerade bei Staffelmiete oder Indexmiete kann sich die Miete häufiger ändern, ohne dass die allgemeinen Grenzen verletzt werden.
Staffelmiete: Erhöhungen stehen schon im Vertrag
Bei einem Staffelmietvertrag ist die Miete von Anfang an gestaffelt, zum Beispiel jedes Jahr 20 Euro mehr. Diese Staffelungen sind im Mietvertrag schriftlich und genau beziffert (§ 557a BGB). Der Vermieter oder die Vermieterin darf dann keine zusätzlichen Mieterhöhungen verlangen. Auch die Kappungsgrenze gilt hier nicht.
Wichtig: Zwischen zwei Staffel-Erhöhungen muss mindestens ein Jahr liegen. Diese Erhöhungen sind automatisch wirksam. Du musst als Mieter:in nicht extra zustimmen.
Indexmiete: Erhöhung nach Inflation
Bei einer Indexmiete richtet sich die Miete nach dem offiziellen Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamts (§ 557b BGB). Steigt dieser Index, kann auch deine Miete steigen und zwar unabhängig von der Kappungsgrenze.
Es gibt dabei keine Begrenzung in Prozent oder Zeitraum, sondern nur die Vorgabe: ein Jahr muss zwischen zwei Anpassungen liegen. Auch hier gilt: Der Vermieter oder die Vermieterin muss die Änderung schriftlich begründen – mit Verweis auf den Indexwert.
Modernisierung: Sonderfall mit Extra-Spielraum
Wenn der Vermieter oder die Vermieterin deine Wohnung modernisiert – etwa mit neuen Fenstern oder Heizungen – darf er oder sie die Miete zusätzlich erhöhen (§ 559 BGB). Dabei darf er oder sie 8 % der Modernisierungskosten jährlich auf die Miete umlegen.
Diese Erhöhung zählt nicht zur Kappungsgrenze und kann theoretisch auch während laufender Mieterhöhungsfristen stattfinden. Aber Achtung: Reine Instandhaltungen (also Reparaturen) berechtigen nicht zur Mieterhöhung.
Nebenkosten getrennt von der Grundmiete
Eine Änderung bei den Nebenkosten zählt nicht als Mieterhöhung im rechtlichen Sinn. Die Nebenkostenabrechnung kann jährlich angepasst werden, wenn die Nebenkosten gestiegen sind – zum Beispiel wegen höherer Heizkosten. Diese Änderungen darf der Vermieter oder die Vermieterin sogar mehrmals im Jahr weitergeben, wenn sich die Preise ändern.
Wusstest du, dass du die Nebenkostenabrechnung prüfen lassen kannst? Erfahre mehr dazu in unserem Artikel zum Thema.
Neuvermietung: keine Begrenzung beim Mietpreis
Wenn du ausziehst und jemand Neues einzieht, gelten die Erhöhungsgrenzen nicht. Dann darf der Vermieter oder die Vermieterin den Mietpreis frei festlegen – mit einer Einschränkung: In Gebieten mit Mietpreisbremse darf die neue Miete nur maximal 10 % über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen (§ 556d BGB). Aber auch hier gibt es wieder Ausnahmen, zum Beispiel bei Neubauten oder umfassend modernisierten Wohnungen.
Mieterhöhung kommt oft: Was kannst du dagegen tun?
Wenn du eine Mieterhöhung bekommst, musst du nicht sofort zustimmen. Es gibt klare gesetzliche Vorgaben, an die sich Vermieter halten müssen und du hast das Recht, die Forderung genau zu prüfen.
Die folgenden Infos dienen als erste Orientierung. Sie ersetzen keine Rechtsberatung durch eine Anwältin oder einen Anwalt für Mietrecht. Lass deine individuelle Situation am besten fachlich durch Expert:innen prüfen, denn unsere Infos können unvollständig oder veraltet sein.
Form und Begründung müssen stimmen
Eine Mieterhöhung muss schriftlich erfolgen und gut begründet sein (§ 558a BGB). Der Vermieter oder die Vermieterin muss darin erklären, warum die Miete steigen soll. Zum Beispiel mit einem Vergleich zum Mietspiegel, zu mindestens 3 Vergleichswohnungen oder durch ein Gutachten. Fehlt eine dieser Begründungen oder ist sie fehlerhaft, kannst du die Mieterhöhung ablehnen.
Zustimmung ist notwendig
Damit die neue Miete überhaupt gilt, musst du zustimmen. Du hast dafür eine Überlegungsfrist von 2 Monaten ab Zugang des Schreibens (§ 558b Abs. 2 BGB). Stimmst du nicht zu, kann der Vermieter oder die Vermieterin erst nach Ablauf der Frist auf Zustimmung klagen. Unterschreibe also nichts vorschnell. Lies alles genau durch oder lasse es im Zweifel von einer Anwältin, einem Anwalt oder einem Mieterverein prüfen.
Ist die neue Miete noch ortsüblich?
Die Miete darf nur bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete erhöht werden. Diese wird meist durch den Mietspiegel der Stadt oder Gemeinde bestimmt. Du kannst dort nachsehen, ob der verlangte Betrag noch im Rahmen liegt. Besonders hilfreich sind qualifizierte Mietspiegel, die regelmäßig aktualisiert werden und nach Wohnlage, Baujahr, Ausstattung usw. differenzieren.
Was tun bei unberechtigter Erhöhung?
Wenn du feststellst, dass die Mieterhöhung formale Fehler hat, zu hoch ist oder gegen gesetzliche Fristen verstößt, kannst du sie schriftlich zurückweisen. Bleib dabei sachlich, nenne die Gründe und verweise auf die passende Rechtsnorm. Mit anwaltlicher Unterstützung kannst du dir weitere Möglichkeiten erklären und aufzeigen lassen.
Es kann sich also lohnen, eine Beratung beim Mieterschutzbund oder bei einer Anwältin oder einem Anwalt für Mietrecht in Anspruch zu nehmen. Oft lassen sich so ungerechtfertigte Erhöhungen vermeiden oder zumindest abmildern.
Fazit
Die Frage nach der Mieterhöhung ist gesetzlich klar geregelt – zumindest, wenn du einen klassischen Mietvertrag ohne Sonderregelung hast. In der Regel darf die Miete nur alle 15 Monate steigen, wobei innerhalb von 3 Jahren maximal 20 % (bzw. 15 %) erlaubt sind. Doch es gibt Ausnahmen: Bei Staffelmieten, Indexmieten oder Modernisierungen gelten andere Regeln. Wichtig ist, dass du jede Mieterhöhung genau prüfst, denn sie ist nur wirksam, wenn du zustimmst. Lass dich im Zweifel beraten, bevor du etwas unterschreibst.