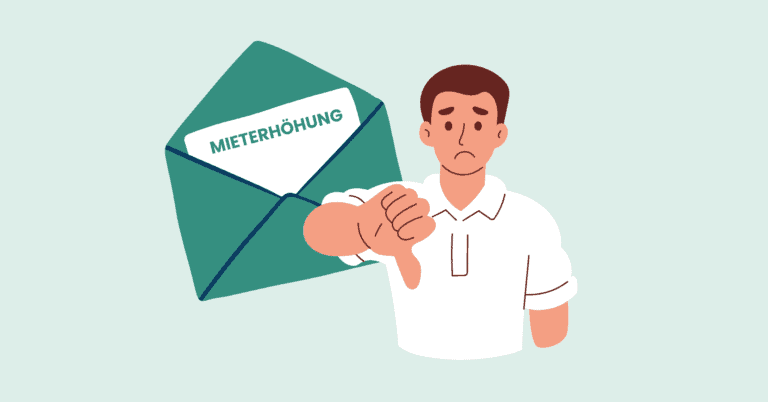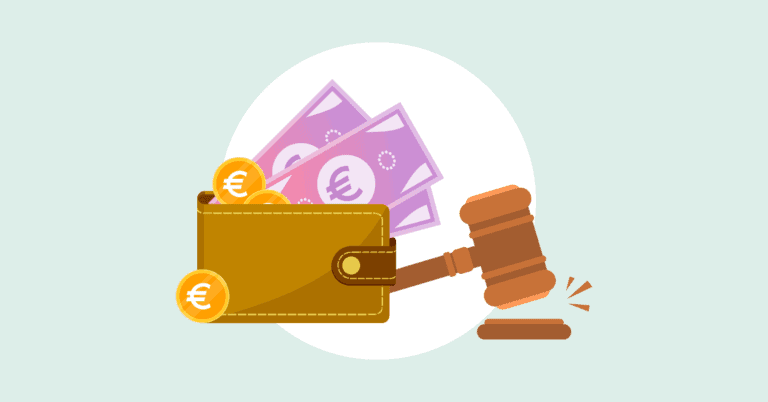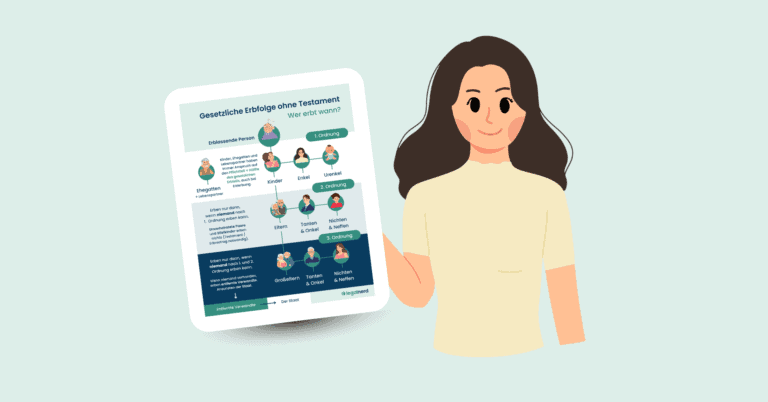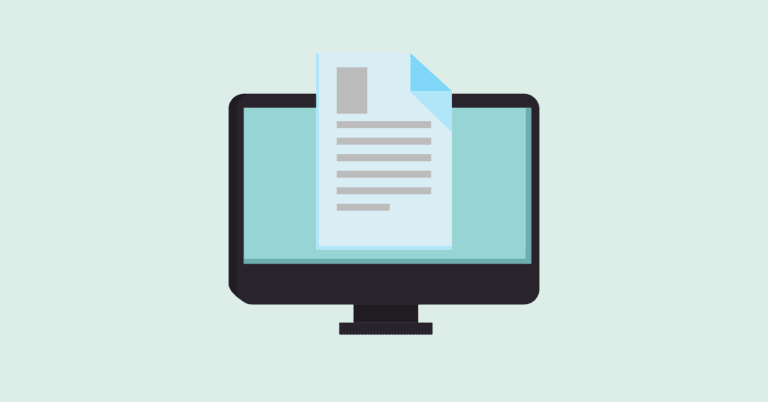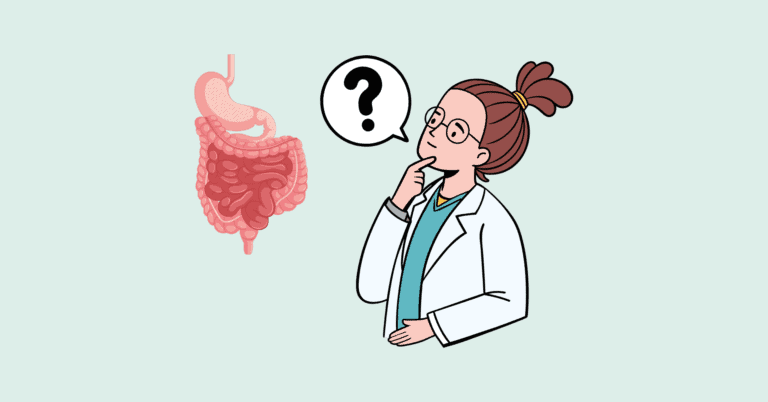Viele Produkte und digitale Dienste stammen aus Konzernen, die einst aus kleineren, eigenständigen Firmen hervorgegangen sind. Die Fusion von Unternehmen, also Zusammenschlüsse sorgen regelmäßig für Aufregung bei Mitarbeiter:innen, Kund:innen, Investor:innen und nicht zuletzt bei den Kartellbehörden. Doch was steckt wirklich dahinter? Warum entscheiden sich Unternehmen dazu, ihre Eigenständigkeit aufzugeben? Und was bedeutet das für alle Beteiligten? Erfahre mehr in diesem Artikel.
Wir bei legalnerd erklären Jura einfach und verständlich. Du willst mehr? Abonniere unseren wöchentlichen kostenlosen Newsletter oder folge uns auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!
Wir bei legalnerd erklären Jura einfach und verständlich. Du willst mehr? Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, höre in unseren Podcast rein oder folge uns auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!
Das Wichtigste in Kürze
✅ Bei einer Fusion von Unternehmen schließen sich zwei Firmen entweder zu einem neuen Unternehmen zusammen oder eine Firma wird vollständig in die andere eingegliedert. Dabei verlieren mindestens eine oder sogar beide ihre rechtliche Selbstständigkeit.
✅ Der Zusammenschluss erfolgt nicht spontan, sondern durch einen detaillierten und rechtlich abgesicherten Prozess. Wichtige Meilensteine sind der Verschmelzungsvertrag, die Zustimmung der Gesellschafter:innen, die Prüfung durch Wirtschaftsprüfer:innen und die Eintragung im Handelsregister. Erst danach ist die Fusion rechtswirksam.
✅ Auch Mitarbeiter:innen sind von Fusionen betroffen – etwa durch neue Organisationsstrukturen, Standorte oder Arbeitgeber:innen. Arbeitsverträge bleiben aber bestehen und Kündigungsschutz greift weiterhin. In bestimmten Fällen werden Sozialpläne erstellt oder Übergangsregelungen über den Betriebsrat getroffen.
✅ Damit durch Fusionen keine Monopole entstehen oder der Markt verzerrt wird, prüfen Kartellbehörden wie das Bundeskartellamt oder die Europäische Kommission jede größere Fusion. Wird der Wettbewerb zu stark eingeschränkt, können Zusammenschlüsse auch verboten oder mit Auflagen versehen werden.
✅ Unternehmen verfolgen mit einer Fusion meist wirtschaftliche Ziele, wie Effizienzsteigerung, Marktanteil-Vergrößerung oder Steueroptimierung. Gleichzeitig können auch strategische oder politische Gründe eine Rolle spielen, etwa bei Rettungsfusionen oder um Zugang zu Technologien und Know-how zu erhalten.
Fusion von Unternehmen: Das steckt dahinter
Du hast bestimmt schon mal gehört, dass zwei Firmen „fusionieren“ – also zusammengelegt werden. Vor allem bei großen Konzernen liest man das regelmäßig in den Nachrichten. Doch was steckt hinter einer Fusion von Unternehmen genau? Es heißt oft, man wolle „Synergien nutzen“, „Kosten sparen“ oder sogar problematisch ausgedrückt „Mitarbeiter abbauen“. Aber was bedeutet das konkret – und wie läuft so etwas ab?
Ganz einfach gesagt: Wenn zwei Firmen fusionieren, wird daraus rechtlich gesehen ein einziges neues Unternehmen. Das kann bedeuten, dass ein Unternehmen im anderen aufgeht, oder dass beide Firmen gemeinsam ein neues Unternehmen gründen. In jedem Fall verliert mindestens eine Firma ihre rechtliche Selbstständigkeit. Dieser Zusammenschluss wird oft auch als Verschmelzung bezeichnet.
Unsere Plattform dient der rechtlichen Aufklärung. Dies ersetzt jedoch keine Rechtsberatung durch Expert:innen, die wir gerne vermitteln. Mit dem Ausfüllen des Formulars willigst du in diese Datenverarbeitung ein. Deine Daten werden rechtskonform verarbeitet und können jederzeit auf Anfrage gelöscht werden. Mehr Infos dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Verschiedene Arten von Fusionen von Unternehmen
Das deutsche Umwandlungsgesetz (UmwG) regelt, wie so eine Fusion juristisch funktioniert. In § 2 UmwG steht: “Rechtsträger können unter Auflösung ohne Abwicklung verschmolzen werden
- im Wege der Aufnahme durch Übertragung des Vermögens eines Rechtsträgers oder mehrerer Rechtsträger (übertragende Rechtsträger) als Ganzes auf einen anderen bestehenden Rechtsträger (übernehmender Rechtsträger) oder
- im Wege der Neugründung durch Übertragung der Vermögen zweier oder mehrerer Rechtsträger (übertragende Rechtsträger) jeweils als Ganzes auf einen neuen, von ihnen dadurch gegründeten Rechtsträger
gegen Gewährung von Anteilen oder Mitgliedschaften des übernehmenden oder neuen Rechtsträgers an die Anteilsinhaber (Gesellschafter, Partner, Aktionäre oder Mitglieder) der übertragenden Rechtsträger.”
Klingt kompliziert – heißt aber: Eine Firma kann ihr gesamtes Vermögen auf eine andere übertragen und dabei selbst aufhören zu existieren. Es gibt also verschiedene Arten von Fusionen.
Die wichtigsten sind:
- Verschmelzung durch Aufnahme: Ein Unternehmen übernimmt das andere komplett. Das übernommene Unternehmen hört auf zu existieren.
- Verschmelzung durch Neugründung: Zwei oder mehrere Unternehmen gründen zusammen ein neues Unternehmen. Die bisherigen Firmen lösen sich dabei auf.
- Fusion über einen Konzern: Ein Konzern übernimmt Tochtergesellschaften komplett, um sie zusammenzulegen und Verwaltungskosten zu sparen.
So ein Zusammenschluss kann freiwillig sein – oft wollen zwei Firmen zum Beispiel ihre Marktposition stärken, neue Kundenkreise erschließen oder gemeinsam günstiger produzieren. Gerade bei techniklastigen Branchen können Fusionen große Vorteile bringen: Fachwissen wird gebündelt, doppelte Investitionen vermieden. Unternehmen verschaffen sich dadurch auch Zugriff auf Patente oder neue Märkte.
Fusionen können aber auch Teil einer Rettungsaktion sein. Wenn eine Firma wirtschaftlich angeschlagen ist, kann ein:e starke:r Partner:in durch eine Fusion helfen, Insolvenz zu vermeiden. Manche Fusionen wurden sogar durch politische Entscheidungen oder Wirtschaftskrisen angestoßen – wie bei Banken während der Finanzkrise.
Wissenswertes zur Fusion von Unternehmen
Eine Fusion bedeutet auch Veränderungen: für Mitarbeiter:innen, Kund:innen sowie für den Markt insgesamt. Daher wird jede geplante Fusion zunächst genau geprüft – insbesondere von den Kartellbehörden wie dem Bundeskartellamt. Sie schauen, ob der Zusammenschluss zu viel Marktmacht schafft – also zum Beispiel dafür sorgt, dass es in einer Branche kaum noch Wettbewerb gibt. In solchen Fällen kann eine Fusion auch verboten werden.
Eine Fusion ist kein Unternehmenskauf!
Nicht zu verwechseln ist die Fusion mit einem Unternehmenskauf. Bei einer Fusion arbeiten beide vorher eigenständigen Unternehmen nachher gemeinschaftlich weiter. Bei einem Unternehmenskauf geht der Käufer oft allein aus dem Geschäft als Inhaber hervor. Trotzdem nutzen Konzerne manchmal beide Strategien parallel. Erfahre mehr zum Thema Firma verkaufen in einem anderen Beitrag von uns.
Auch steuerliche Gründe spielen bei Fusionen eine große Rolle. Unternehmen versuchen oft, ihre Strukturen so zu verändern, dass sie weniger Steuern zahlen – etwa durch die Zusammenführung von verlustreichen und profitablen Betrieben. Diese Vorgänge sind in der Regel legal, solange sie die Vorschriften aus dem Körperschaftsteuergesetz oder dem Abgabenordnung einhalten.
Eine Fusion ist also weder eine einfache Entscheidung noch ein schneller Prozess. Es geht dabei nicht nur um den Zusammenschluss zweier Unternehmen – sondern um ein komplexes Projekt mit rechtlicher, wirtschaftlicher und oft auch emotionaler Bedeutung für alle Beteiligten.
Wie läuft eine Fusion von Unternehmen ab?
Eine Fusion von Unternehmen ist ein komplexer rechtlicher Vorgang, bei dem zwei oder mehr Firmen zu einer neuen Einheit verschmelzen oder eine Firma in eine andere aufgeht. Das passiert nicht einfach so – der deutsche Gesetzgeber hat klare Regeln aufgestellt, wie so ein Unternehmenszusammenschluss Schritt für Schritt abläuft. Grundlage ist dabei vor allem das Umwandlungsgesetz (UmwG). Es regelt genau, wie Unternehmen ihre Rechtsform ändern, sich zusammenschließen oder aufspalten dürfen.
Verschmelzungsvertrag bei der Fusion von Unternehmen
Der wichtigste juristische Schritt bei einer Fusion ist der sogenannte Verschmelzungsvertrag. Darin legen die beteiligten Unternehmen fest, wer mit wem fusioniert, welche Firma bestehen bleibt (oder ob eine neue daraus entsteht), wie die Anteile verteilt werden und was mit dem Betriebsvermögen passiert.
Dieser Vertrag muss von der Geschäftsführung beider Unternehmen ausgehandelt und unterschrieben werden. Anschließend müssen auch die Gesellschafter:innen oder Aktionär:innen zustimmen – oft in einer extra einberufenen Versammlung.
Eine Fusion kann auf zwei Arten ablaufen: Entweder wird ein Unternehmen auf ein anderes verschmolzen, das dann allein weiterbesteht (Verschmelzung durch Aufnahme). Oder beide Firmen gehen in einem neuen Unternehmen auf (Verschmelzung durch Neugründung). In beiden Fällen regelt der Verschmelzungsvertrag die Details – zum Beispiel, wie viel die bisherigen Anteilseigner:innen im neuen Unternehmen bekommen.
Doppelte Buchführung bei Unternehmensfusion
Ein wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang ist die doppelte Buchführung beim Fusionsprozess. Ehe es zur Eintragung kommt, müssen die Unternehmen ihre Vermögenswerte, Schulden und andere rechtliche Verpflichtungen offenlegen und bewerten. Ziel ist, dass ein fairer Zusammenschluss stattfindet und keine Seite bevorzugt oder benachteiligt wird. Juristisch nennt man das die sogenannte Prüfung des Verschmelzungsvertrags. Sie erfolgt durch neutrale Sachverständige oder Wirtschaftsprüfer:innen.
Eintragung ins Handelsregister
Der nächste rechtliche Schritt ist die Eintragung ins Handelsregister. Erst wenn die Fusion dort eingetragen ist, ist sie rechtlich wirksam (§ 20 Abs. 1 UmwG). Zuständig ist das Handelsregister am Arbeitsplatz des jeweiligen Unternehmenssitzes. Die Eintragung zeigt der Öffentlichkeit, dass die Unternehmen jetzt rechtlich als ein gemeinsames Unternehmen auftreten. Ab diesem Zeitpunkt gelten auch alle arbeitsrechtlichen und vertraglichen Veränderungen als verbindlich.
Umwandlungsrecht
Während des gesamten Prozesses gilt das sogenannte Umwandlungsrecht: es beschreibt in verschiedenen Paragraphen, wie etwaige Gläubiger:innen geschützt werden, oder was passiert, wenn Beschäftigte von der Fusion betroffen sind. Relevant ist hier zum Beispiel § 324 UmwG, der regelt, dass die Rechte der Gläubiger:innen durch Sicherheiten geschützt werden müssen, wenn die Rechtsform geändert wird.
Auch steuerrechtliche Fragen spielen eine wichtige Rolle. Die Fusion ist für die Steuerbehörden ein sogenannter steuerneutraler Vorgang, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Das heißt, dass das Vermögen ohne neue Steuerschuld auf das neue Unternehmen übergehen kann. Diese Regelung ist vor allem in der Umwandlungssteuergesetz (UmwStG) zu finden. In manchen Fällen prüfen auch die Kartellbehörden, ob durch die Fusion ein Wettbewerbsnachteil entsteht.
Fazit: Eine Fusion ist rechtlich ein streng geregelter Ablauf. Ohne Zustimmung der Gesellschafterversammlung, ohne Prüfung durch Sachverständige und ohne Eintrag ins Handelsregister darf eine Fusion in Deutschland nicht vollzogen werden. Als Betroffener – ob Mitarbeiter:in oder Anteilseigner:in – solltest du genau hinschauen, was im Verschmelzungsvertrag steht und wie die rechtliche Situation sich durch den Zusammenschluss ändert.
Fusion von Unternehmen: Deine Rechte als Mitarbeiter
Wenn deine Firma mit einem anderen Unternehmen zusammengeht, kann das viele Fragen bei dir aufwerfen: Bleibt mein Job erhalten? Bekomme ich einen neuen Chef oder Vertrag? Muss ich umziehen? Eine Fusion von Unternehmen betrifft nämlich nicht nur die Chefetagen, sondern auch dich als Mitarbeiter:in. Deshalb erfährst du hier, welche Rechte du hast und was rechtlich mit deinem Arbeitsverhältnis passiert.
Arbeitsvertrag
Zuerst die gute Nachricht: Dein Arbeitsvertrag bleibt in der Regel bestehen. Wenn zwei Unternehmen fusionieren, spricht man rechtlich oft von einer „Verschmelzung“ im Sinne des § 2 Umwandlungsgesetz (UmwG). Dabei übernimmt ein Unternehmen alle Rechte und Pflichten des anderen – und dazu gehört auch dein Arbeitsvertrag. Nach § 613a BGB werden alle bestehenden Arbeitsverhältnisse automatisch auf das neue Unternehmen übertragen.
Du musst also keinem neuen Vertrag zustimmen. Das nennt man auch „Betriebsübergang„. Deine Arbeitsbedingungen – wie Gehalt, Urlaubstage, Arbeitszeit oder dein Einsatzort – dürfen sich auch nicht einfach verschlechtern. Falls das neue Unternehmen daran etwas ändern möchte, benötigst du dafür deine Zustimmung oder eine rechtlich zulässige Änderungskündigung.
Allerdings bist du nicht gezwungen, den Übergang mitzumachen. Du kannst diesem widersprechen. Das geht bis spätestens einen Monat nachdem du über den Übergang schriftlich informiert wurdest. Dann bleibst du zwar beim alten Arbeitgeber – aber wenn dieser Betrieb durch die Fusion von Unternehmen aufgelöst wird, kann das zur Kündigung führen. Ein Widerspruch sollte also gut überlegt sein.
Betriebsrat
Wenn deine Firma fusioniert, bringt das oft auch Veränderungen in der Organisation mit sich. Gibt es in beiden Unternehmen jeweils einen Betriebsrat, müssen diese sich abstimmen. Bei größeren Fusionen kann auch ein neuer gemeinsamer Betriebsrat gewählt werden. Laut § 21a Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) kann für die Übergangszeit ein „Gesamtbetriebsrat“ oder ein Übergangs-Betriebsrat bestehen bleiben, bis eine neue Wahl stattgefunden hat.
Der Betriebsrat hat bei der Fusion eine wichtige Rolle: Er muss über die geplanten Veränderungen informiert und angehört werden. In manchen Fällen steht ihm sogar ein Mitbestimmungsrecht zu – zum Beispiel bei Umstrukturierungen, Versetzungen oder Personalabbau. Du kannst dich also an den Betriebsrat wenden, wenn du Fragen oder Sorgen hast. Er ist dazu da, deine Interessen während der Fusion zu vertreten.
Auch Sozialpläne können in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen. Wenn durch die Fusion Stellen abgebaut oder Arbeitsbedingungen deutlich verändert werden, kann ein Sozialplan Abhilfe schaffen. Darin wird geregelt, wie Mitarbeiter:innen entschädigt werden – etwa durch Abfindungen, Umschulungen oder Unterstützungen bei der Jobsuche. Diese Pläne werden in der Regel zwischen dem Unternehmen und dem Betriebsrat ausgehandelt.
Betriebszugehörigkeit
Deine Betriebszugehörigkeit bleibt grundsätzlich bestehen. Das heißt: Dein Anspruch auf Kündigungsschutz, Urlaub oder Betriebsrente ändert sich nicht, nur weil ein:e neue:r Arbeitgeber:in übernimmt.
Möglich ist aber, dass sich der Arbeitsort durch die Fusion ändert – etwa wenn zwei Standorte zusammengelegt werden. Hier gilt: Dein ursprünglicher Arbeitsvertrag entscheidet, ob dein Arbeitgeber dir einen neuen Einsatzort vorschreiben kann. Steht dort ein konkreter Arbeitsort, brauchst du nicht ohne Weiteres umzuziehen. Gibt es jedoch eine sogenannte Versetzungsklausel, ist mehr Flexibilität vorgesehen. Im Streitfall solltest du dich rechtlich beraten lassen.
Eine Fusion ist kein Freifahrtschein für Kündigungen. Der bloße Zusammenschluss zweier Firmen reicht laut § 1 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) nicht aus, um eine Kündigung sozial zu rechtfertigen. Es müssen handfeste Gründe vorliegen – zum Beispiel betriebsbedingte Kündigungen wegen Wegfall von Arbeitsplätzen. Und selbst dann gilt der allgemeine Kündigungsschutz weiterhin für dich.
Auch wenn große Unternehmen fusionieren, bist du als Mitarbeiter:in rechtlich nicht schutzlos. Informiere dich frühzeitig, sprich mit dem Betriebsrat und lass dich beraten, wenn du unsicher bist. So kannst du rechtzeitig reagieren – und weißt genau, was dir zusteht.
Kontrolle durch Kartellbehörden bei Fusionen von Unternehmen
Wenn zwei große Firmen sich zusammenschließen wollen, bleibt das nicht unbeobachtet. Denn eine Fusion von Unternehmen kann den Wettbewerb auf dem Markt stark verändern. Deshalb gibt es in Deutschland klare Regeln und eine unabhängige Behörde, die genau prüft, ob der Zusammenschluss erlaubt werden darf: das Bundeskartellamt.
Diese Kontrolle nennt sich Fusionskontrolle. Ihr Ziel ist es, zu verhindern, dass Unternehmen durch eine Fusion eine zu starke Stellung am Markt erlangen. Denn wenn es nur noch wenige Anbieter gibt, können Preise steigen, die Auswahl für dich als Verbraucher wird kleiner und Innovationen bleiben womöglich aus.
Wann muss eine Fusion gemeldet werden?
Das Bundeskartellamt wird nicht bei jedem Zusammenschluss automatisch tätig. Eine Meldung ist nach dem § 35 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) nur dann verpflichtend, wenn bestimmte wirtschaftliche Schwellen überschritten werden. Diese Grenzen beziehen sich auf die Umsätze der beteiligten Unternehmen. Damit soll verhindert werden, dass sehr kleine Zusammenschlüsse unnötig geprüft werden.
Außerdem gibt es eine sogenannte Transaktionswert-Schwelle. Nach § 35 Abs. 1a GWB müssen Unternehmen auch dann eine Fusion anmelden, wenn die Übernahme über 400 Millionen Euro kostet und das übernommene Unternehmen erhebliche Aktivitäten in Deutschland hat – selbst wenn sein Umsatz gering ist.
Wie läuft das Prüfverfahren ab?
Nach Eingang der Anmeldung prüft das Bundeskartellamt den Zusammenschluss. Dies geschieht in zwei Stufen:
Phase 1 ist ein Schnellverfahren und dauert maximal einen Monat. In dieser Phase wird geschaut, ob der Zusammenschluss offensichtlich unbedenklich ist. Das ist oft der Fall, wenn die Firmen in ganz unterschiedlichen Branchen tätig sind oder ihre Marktanteile weiterhin klein bleiben.
Phase 2 folgt, wenn es ernsthafte Bedenken gibt. Dann dauert das Verfahren länger – meist etwa vier Monate. In dieser Phase werden Marktanalysen gemacht, Wettbewerber befragt und mögliche negative Folgen untersucht.
Wann ist eine Unternehmensfusion verboten?
Ein Zusammenschluss wird untersagt, wenn zu befürchten ist, dass er eine marktbeherrschende Stellung schafft oder verstärkt – das besagt § 36 GWB. Marktbeherrschend bedeutet: Das neue Unternehmen hätte so viel Einfluss, dass es sich unabhängig vom Wettbewerb verhalten könnte. Das betrifft insbesondere die Preisgestaltung, Vertragsbedingungen oder das Angebot an Produkten und Services. Wenn also zum Beispiel die zwei größten Verkäufer von Mobilfunkverträgen fusionieren wollen, könnte das problematisch für Verbraucher:innen sein.
Was passiert, wenn eine Fusion ohne Genehmigung stattfindet?
Ein Zusammenschluss, der trotz fehlender Freigabe durchgeführt wird, ist nach § 41 GWB nichtig. Das heißt: Die Fusion gilt juristisch nicht als erfolgt. Die Unternehmen müssen die wirtschaftlichen Verbindungen rückgängig machen, was in der Praxis sehr kompliziert sein kann.
Zudem kann das Bundeskartellamt Bußgelder verhängen – und zwar sowohl gegen die Unternehmen als auch gegen verantwortliche Personen. Deshalb nehmen große Gesellschaften die Regeln zur Fusionskontrolle sehr ernst und holen sich oft schon frühzeitig rechtlichen Rat.
In speziellen Fällen kann auch die Europäische Kommission zuständig sein – zum Beispiel, wenn Unternehmen europaweit hohe Umsätze machen. Dann läuft die Prüfung über das EU-Kartellrecht. Dafür gibt es die sogenannte EU-Fusionskontrollverordnung.
Für dich als Verbraucher:in ist diese Kontrolle wichtig, auch wenn du davon im Alltag meist wenig mitbekommst. Denn sie sorgt dafür, dass du weiterhin eine Auswahl an Anbieter:innen hast und keine Firma so groß wird, dass sie allein die Regeln diktieren kann.
Fazit
Die Fusion von Unternehmen ist ein komplexer, aber strategisch bedeutender Schritt, um langfristige Wettbewerbsfähigkeit, Markterweiterung und Kosteneinsparungen zu erreichen. Wichtig ist dabei, dass Unternehmen im Vorfeld eine sorgfältige Due-Diligence-Prüfung durchführen, strategische Ziele klar definieren und frühzeitig die Integration von Unternehmensstrukturen, Unternehmenskulturen und Mitarbeiter:innen planen. Auch rechtliche, steuerliche und datenschutzrechtliche Aspekte spielen eine zentrale Rolle im Fusionsprozess.
Ein erfolgreicher Zusammenschluss hängt maßgeblich von einer transparenten Kommunikation, professionellem Change Management und der aktiven Einbindung aller Stakeholder ab. Langfristig können Unternehmen so nicht nur ihre wirtschaftliche Stärke erhöhen, sondern auch Innovationen fördern und neue Märkte erschließen. Dennoch gilt: Jede Fusion birgt Risiken und Herausforderungen, weshalb eine fundierte Planung und Expertise unerlässlich sind.