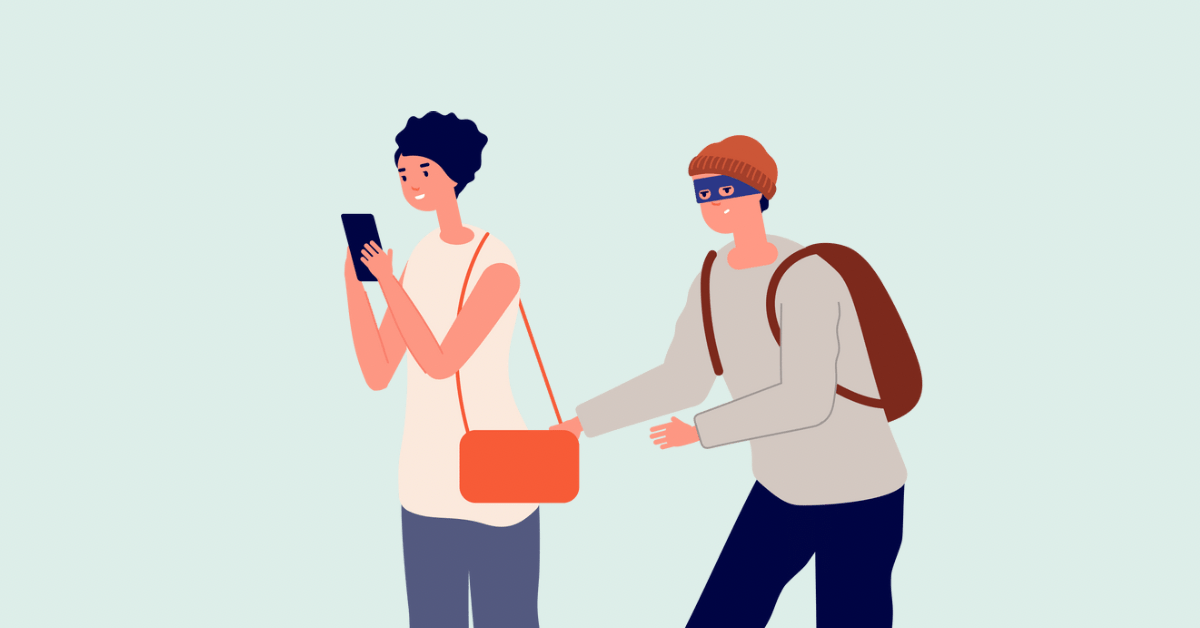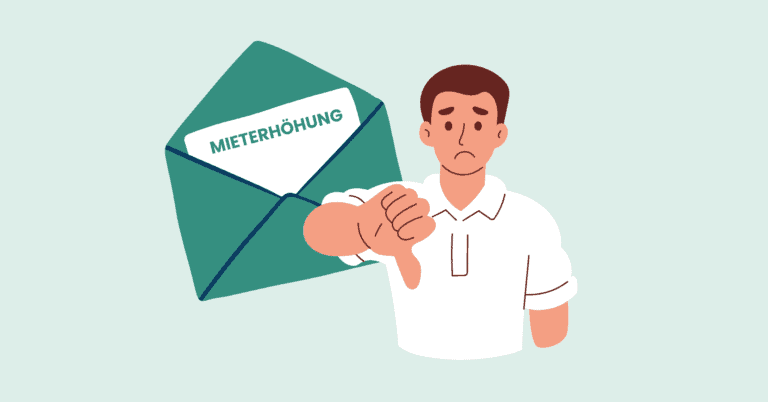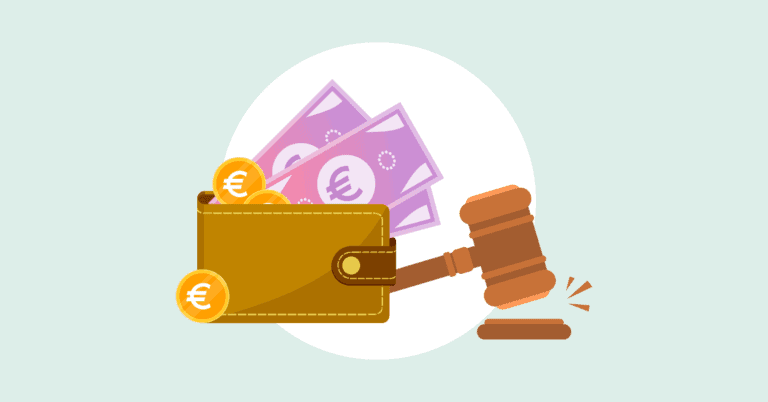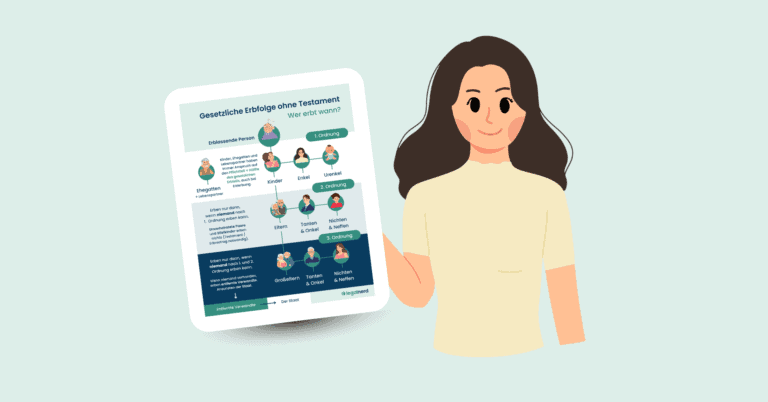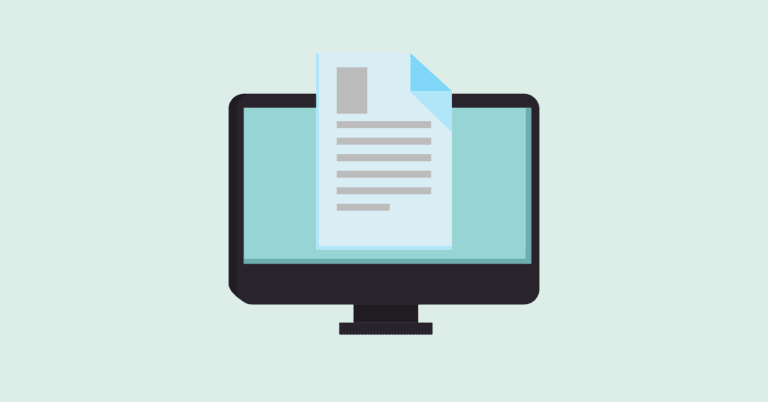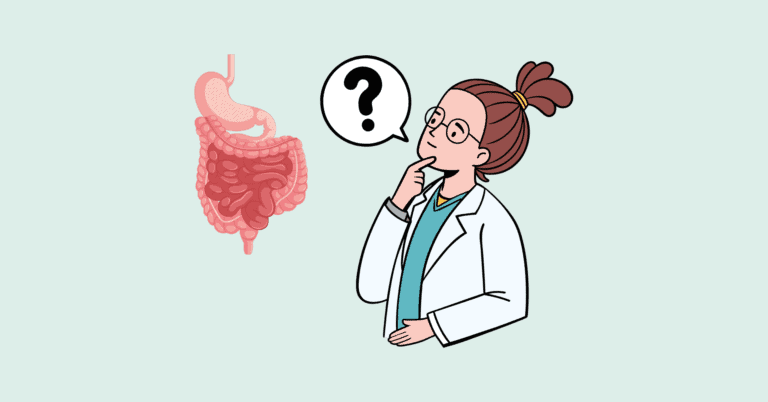Du wolltest nur einen Schokoriegel mitnehmen – oder ein Paar Socken, das gerade im Angebot war. Schnell in die Jackentasche gesteckt, niemand hat’s gesehen. Oder doch? Der Alarm piept, die Polizei wird gerufen. Was als vermeintlich harmlose Aktion beginnt, kann ziemlich ernste Konsequenzen nach sich ziehen. Die Rede ist vom Diebstahl geringwertiger Sachen – ein Delikt, das oft unterschätzt wird, besonders von Jugendlichen oder Ersttätern. Denn selbst wenn der Wert niedrig ist, bleibt es ein Diebstahl. Und der ist strafbar.
Wir bei legalnerd erklären Jura einfach und verständlich. Du willst mehr? Abonniere unseren wöchentlichen kostenlosen Newsletter oder folge uns auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!
In Supermärkten, Drogerien oder Bekleidungsgeschäften passiert das jeden Tag – und immer wieder stehen Menschen vor der Frage: „Was bedeutet das jetzt für mich?“ Genau darum geht es in diesem Text. Wir erklären dir, ab wann eine Sache als geringwertig gilt, was dir rechtlich droht, welche Rolle ein Strafantrag spielt und ob so ein Vorfall im Führungszeugnis auftaucht.
Wir bei legalnerd erklären Jura einfach und verständlich. Du willst mehr? Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, höre in unseren Podcast rein oder folge uns auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!
Das Wichtigste in Kürze
✅ Eine Sache gilt als geringwertig, wenn ihr Wert unter ca. 50 Euro liegt. Maßgeblich ist der objektive Marktwert. Die Grenze hat sich aber in der Rechtsprechung durchgesetzt.
✅ Auch bei Diebstahl geringwertiger Sachen machst du dich strafbar. Sogar ein kleiner Ladendiebstahl zu einer Geldstrafe oder – bei Wiederholung – zu Freiheitsstrafen führen.
✅ Ein Strafantrag ist oft erforderlich, damit die Tat überhaupt verfolgt wird, es sei denn, es liegt ein „öffentliches Interesse“ an der Strafverfolgung vor. Ohne Strafantrag kann das Verfahren eingestellt werden – muss aber nicht.
✅ Wenn du bereits mehrfach aufgefallen bist oder besonders dreist gestohlen hast, kann die Staatsanwaltschaft auch ohne Antrag tätig werden.
✅ Ein Diebstahl kann unter Umständen im Führungszeugnis stehen. Entscheidend ist die Höhe der Strafe. Geldstrafen bis 90 Tagessätze oder bestimmte Jugend-Maßnahmen bleiben in der Regel außen vor.
Wann gilt eine Sache als „geringwertig“?
Ob ein Diebstahl strafrechtlich als schwer oder eher „klein“ eingestuft wird, hängt oft davon ab, wie viel die gestohlene Sache wert ist. Das Strafgesetzbuch (StGB) kennt dabei keine feste Liste, was geringwertig ist und was nicht. Stattdessen kommt es auf den objektiven Verkehrswert der Sache an – also den Preis, den man für ein vergleichbares Produkt im Laden zahlen müsste.
Die allgemein anerkannte Grenze liegt bei etwa 50 Euro. Alles, was darunter liegt, wird in der Regel als geringwertig angesehen. Dabei zählt nicht, was der Täter denkt oder hofft, sondern der tatsächliche Marktwert. Ein Parfüm für 49,99 Euro? Geringwertig. Eins für 59 Euro? Nicht mehr. Auch Sonderangebote oder Rabattaktionen spielen keine Rolle – es geht um den üblichen Preis für das Produkt.
Ein wichtiger Unterschied: Die „Geringwertigkeit“ im Strafrecht ist nicht das Gleiche wie im Zivilrecht, wo es zum Beispiel bei Gewährleistung oder Vertragsfragen um andere Beträge geht. Im Strafrecht hat sie vor allem Auswirkungen auf die Strafverfolgung: Denn bei geringwertigen Sachen ist in vielen Fällen ein Strafantrag nötig – sonst passiert oft nichts. Warum das so ist, erklären wir im nächsten Abschnitt genauer.
In der Praxis betrifft das Thema vor allem kleine Diebstähle in Geschäften – etwa Snacks, Kosmetik, Bekleidung oder Technikzubehör. Gerade junge Menschen oder Gelegenheitsdiebe greifen hier zu, oft ohne sich über die Folgen im Klaren zu sein. Dabei ist es egal, wie unbedeutend dir die Sache vorkommt – das Gesetz kennt keine Ausnahmen bei „nur mal eben“.
Die gesetzliche Grundlage für Diebstahl findest du in § 242 StGB. Darin heißt es:
„Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, sie sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“
Kurz gesagt: Auch ein Kaugummi kann eine Straftat auslösen, wenn er ohne zu zahlen mitgenommen wird. Ob du am Ende wirklich bestraft wirst, hängt von mehreren Faktoren ab – dazu mehr im nächsten Abschnitt.
Unsere Plattform dient der rechtlichen Aufklärung. Dies ersetzt jedoch keine Rechtsberatung durch Expert:innen, die wir gerne vermitteln. Mit dem Ausfüllen des Formulars willigst du in diese Datenverarbeitung ein. Deine Daten werden rechtskonform verarbeitet und können jederzeit auf Anfrage gelöscht werden. Mehr Infos dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Wann wird ein Diebstahl trotz Geringwertigkeit verfolgt?
Wenn der Wert der gestohlenen Sache unter 50 Euro liegt, heißt das noch lange nicht, dass du automatisch straffrei bleibst. Es kommt nämlich darauf an, ob ein Strafantrag gestellt wurde. Denn laut § 248a StGB gilt: Der Diebstahl geringwertiger Sachen wird nur auf Antrag verfolgt – es sei denn, es liegt ein besonderes öffentliches Interesse vor.
Das bedeutet: In den meisten Fällen braucht die Polizei oder Staatsanwaltschaft erst mal einen Antrag vom Geschädigten – also zum Beispiel vom Ladeninhaber oder der Marktleitung – bevor sie ein Ermittlungsverfahren einleiten dürfen. Dieser Antrag muss innerhalb von drei Monaten nach der Tat gestellt werden, sonst kann die Tat nicht mehr verfolgt werden (siehe § 77b StGB).
Allerdings gibt es eine wichtige Ausnahme: Wenn ein sogenanntes „öffentliches Interesse an der Strafverfolgung“ besteht, darf die Staatsanwaltschaft auch ohne Strafantrag tätig werden. Doch was heißt das genau? Die Rechtsprechung sagt: Ein öffentliches Interesse besteht zum Beispiel dann, wenn
- die Person schon mehrfach wegen Diebstahl aufgefallen ist,
- in einer besonders dreisten oder aggressiven Weise gestohlen wurde,
- es sich um eine Bande oder eine organisierte Tat handelt,
- oder wenn eine besondere Abschreckung nötig erscheint, etwa bei regelmäßigem Ladendiebstahl in einem betroffenen Stadtteil.
Gerade in Großstädten, in denen bestimmte Geschäfte regelmäßig Ziel von Ladendieben sind, nimmt die Staatsanwaltschaft solche Fälle oft besonders ernst – auch bei geringen Werten.
Ein Strafantrag wird in der Praxis fast immer gestellt. Kaufhäuser und Supermärkte haben oft klare Vorgaben, jeden Diebstahl anzuzeigen – unabhängig vom Warenwert. Sie wollen damit klare Signale setzen, dass Diebstahl nicht geduldet wird. Selbst wenn du nur eine Kleinigkeit mitgehen lässt, kann also schnell die Polizei ins Spiel kommen.
Deshalb lohnt es sich auch nicht, auf „Glück“ zu hoffen – denn die meisten Läden zeigen aus Prinzip alles an. Und sobald der Antrag vorliegt oder die Staatsanwaltschaft ein öffentliches Interesse annimmt, läuft das Verfahren – ganz egal, wie gering der Schaden war.
Wissenswertes zum Strafantrag beim Diebstahl geringwertiger Sachen
Der Strafantrag ist bei Diebstahl geringwertiger Sachen oft der entscheidende Auslöser dafür, ob du strafrechtlich belangt wirst – oder nicht. Denn wie du im letzten Abschnitt gelesen hast, verlangt § 248a StGB für solche Fälle in der Regel einen Antrag des Geschädigten. Das bedeutet: Ohne diesen Antrag kann die Staatsanwaltschaft das Verfahren meist gar nicht führen – es sei denn, es liegt ein öffentliches Interesse vor.
Ein Strafantrag ist nicht das Gleiche wie eine Anzeige. Eine Anzeige kann jeder erstatten – auch eine dritte Person, die die Tat beobachtet hat. Ein Strafantrag hingegen ist ein förmliches Rechtsmittel. Damit erklärt der Geschädigte ausdrücklich, dass er möchte, dass der Täter strafrechtlich verfolgt wird. Nur bestimmte Personen dürfen das tun – in der Regel der Eigentümer der gestohlenen Sache oder ein rechtlicher Vertreter des Ladens (z. b. die Filialleitung).
Der Strafantrag muss innerhalb von 3 Monaten nach Kenntnis von Tat und beschuldigter Person gestellt werden – das steht in § 77b StGB. Wird diese Frist versäumt, kann die Tat nicht mehr verfolgt werden, selbst wenn sie gut dokumentiert ist. Der Antrag kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft gestellt werden.
Manchmal fragen sich Betroffene, ob sie einen bereits gestellten Strafantrag wieder zurücknehmen können. Die Antwort: Ja, das geht – aber nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Nach § 77d StGB kann der Antrag bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens zurückgenommen werden. In der Praxis passiert das aber selten, besonders bei großen Einzelhandelsketten mit klaren internen Vorgaben.
Und wie sieht’s bei Jugendlichen aus? Wenn du noch nicht 18 bist, kommt das Jugendgerichtsgesetz (JGG) zum Einsatz. Der Strafantrag wird dann oft von deinen Eltern oder Erziehungsberechtigten gestellt oder zumindest begleitet. Bei jungen Beschuldigten geht es mehr um Erziehung als um Strafe – trotzdem läuft das Verfahren, sobald ein Antrag gestellt ist.
Zusammengefasst: Der Strafantrag ist bei geringwertigen Diebstählen der „Startknopf“ für das Strafverfahren. Ohne ihn passiert oft nichts – mit ihm kann selbst eine Kleinigkeit schnell zum großen Problem werden.
Wie wirkt sich der Diebstahl geringwertiger Sachen auf das Führungszeugnis aus?
Viele fragen sich nach einem Ladendiebstahl: Steht das jetzt in meinem Führungszeugnis? Die Antwort: Kommt drauf an. Denn nicht jede Verurteilung erscheint dort – aber unter bestimmten Bedingungen eben doch.
Das Führungszeugnis ist ein offizielles Dokument, in dem Vorstrafen aufgeführt werden. Du brauchst es zum Beispiel bei einer Bewerbung im öffentlichen Dienst, für bestimmte Ausbildungen oder bei einer Einbürgerung. Die Regeln, was drinsteht, findest du im Bundeszentralregistergesetz (BZRG).
Laut § 32 BZRG werden nur bestimmte Verurteilungen aufgenommen. Wenn du zum Beispiel zu einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder zu Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten verurteilt wurdest, taucht das in der Regel im Führungszeugnis auf. Liegt die Strafe darunter – etwa 30 oder 60 Tagessätze –, bleibt es meistens draußen. Wichtig: Die Höhe des Tagessatzes richtet sich nach deinem Einkommen, nicht nach dem Wert der gestohlenen Ware.
Wirst du nach Jugendstrafrecht verurteilt, sieht es etwas anders aus. Jugendstrafen erscheinen nur bei sogenannten Zuchtmitteln, also z. b. bei Jugendarrest. Erziehungsmaßregeln oder Verwarnungen stehen in der Regel nicht im Führungszeugnis, auch nicht Sozialstunden.
Außerdem kann eine Verurteilung im erweiterten Führungszeugnis auftauchen – zum Beispiel wenn du mit Kindern oder Jugendlichen arbeiten willst. In diesem Fall sind die Regeln strenger. Selbst kleinere Strafen können dort unter Umständen angegeben werden.
Auch eingestellte Verfahren tauchen im Führungszeugnis nicht auf. Wenn dein Verfahren nach § 153 StPO eingestellt wurde, weil die Schuld als gering angesehen wurde, giltst du offiziell nicht als vorbestraft.
Einmal drin heißt aber nicht für immer: Nach Ablauf bestimmter Fristen (siehe §§ 34, 46 BZRG) werden Einträge wieder gelöscht. Die Frist beträgt meistens drei Jahre, kann aber je nach Strafe auch kürzer oder länger sein.
Ob ein Ladendiebstahl also dein Führungszeugnis belastet, hängt stark von der Strafe ab. Wer mit einem blauen Auge davonkommt, bleibt oft „sauber“. Wer mehrfach auffällt oder eine hohe Geldstrafe kassiert, hat Pech – und das kann dich im Berufsleben oder bei behördlichen Anträgen einholen.
Fazit: Geringer Wert schützt nicht vor Strafe
Der Diebstahl geringwertiger Sachen wirkt auf den ersten Blick harmlos. Ein Kaugummi hier, ein Make-up dort – was soll schon passieren? Doch rechtlich ist die Lage klar: Es handelt sich um eine Straftat. Und die kann verfolgt, bestraft und sogar im Führungszeugnis vermerkt werden. Entscheidend ist, ob ein Strafantrag gestellt wird, ob du schon vorher auffällig warst und wie hoch deine Strafe am Ende ausfällt.
Auch kleine Taten können große Folgen haben – für deine Ausbildung, deinen Job oder dein Ansehen. Deshalb solltest du die Sache nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wer einmal erwischt wird, bekommt oft noch eine Chance. Wer öfter auffällt, muss mit harten Konsequenzen rechnen.